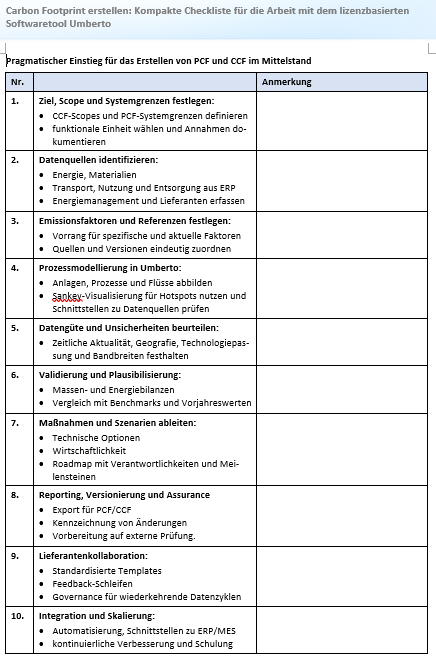07211 Carbon Footprint nachweisen: Grundlagen, rechtliche Rahmenbedingungen, Software-Tools und Beispiele aus der Industrie
|
Dieser Fachartikel bietet Geschäftsführenden kleiner und mittelständischer Unternehmen einen praxisorientierten Leitfaden zur Erstellung von Carbon Footprints. Er erläutert die aktuellen rechtlichen Anforderungen, stellt bewährte Software-Tools vor und zeigt anhand konkreter Beispiele, wie andere KMU erfolgreich ihre CO2-Bilanzierung umgesetzt haben. Ziel ist es, den Einstieg in die Carbon Footprint-Berechnung zu erleichtern und aufzuzeigen, wie diese als strategisches Instrument für nachhaltiges Wirtschaften genutzt werden kann. Arbeitshilfen: von: |
Dieser Text wurde mit Unterstützung einer Künstlichen Intelligenz erstellt. [1]
1 Einleitung
Der Carbon Footprint entwickelt sich vom „Nice-to-have” zum „Must-have”. KMU, die jetzt aktiv werden, sichern sich Wettbewerbsvorteile und gestalten die nachhaltige Transformation aktiv mit. Der Weg zur Klimaneutralität beginnt mit dem ersten Schritt – der Messung des Status quo.
Definition des Carbon Footprints
Der Carbon Footprint, auch CO2-Fußabdruck genannt, quantifiziert die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen, die direkt oder indirekt durch Aktivitäten eines Unternehmens oder die Herstellung eines Produkts verursacht werden. Diese Emissionen werden in CO2-Äquivalenten (CO2e) ausgedrückt, um verschiedene Treibhausgase vergleichbar zu machen. Die Berechnung erfolgt nach international anerkannten Standards wie ISO 14064-1 für Unternehmen oder ISO 14067 für Produkte.
Abb. 1: Stilisierter Carbon Footprint [2]
Der Carbon Footprint, auch CO2-Fußabdruck genannt, quantifiziert die Gesamtmenge an Treibhausgasemissionen, die direkt oder indirekt durch Aktivitäten eines Unternehmens oder die Herstellung eines Produkts verursacht werden. Diese Emissionen werden in CO2-Äquivalenten (CO2e) ausgedrückt, um verschiedene Treibhausgase vergleichbar zu machen. Die Berechnung erfolgt nach international anerkannten Standards wie ISO 14064-1 für Unternehmen oder ISO 14067 für Produkte.
Bedeutung für mittelständische Unternehmen
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland wird die Carbon-Footprint-Berechnung zunehmend geschäftskritisch. Während große Konzerne bereits seit Jahren Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, stehen KMU nun vor der Herausforderung, ihre Klimawirkung transparent zu machen. Dies geschieht nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern auch aufgrund steigender Anforderungen von Geschäftspartnern, Banken und Kunden. Die systematische Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemissionen wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und kann gleichzeitig Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerungen ermöglichen.
Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) in Deutschland wird die Carbon-Footprint-Berechnung zunehmend geschäftskritisch. Während große Konzerne bereits seit Jahren Nachhaltigkeitsberichte veröffentlichen, stehen KMU nun vor der Herausforderung, ihre Klimawirkung transparent zu machen. Dies geschieht nicht nur aus regulatorischen Gründen, sondern auch aufgrund steigender Anforderungen von Geschäftspartnern, Banken und Kunden. Die systematische Erfassung und Reduktion von Treibhausgasemissionen wird zum entscheidenden Wettbewerbsfaktor und kann gleichzeitig Kosteneinsparungen durch Effizienzsteigerungen ermöglichen.
Dieser Fachartikel bietet Geschäftsführenden kleiner und mittelständischer Unternehmen einen praxisorientierten Leitfaden zur Erstellung von Carbon Footprints. Er erläutert die aktuellen rechtlichen Anforderungen, stellt bewährte Software-Tools vor und zeigt anhand konkreter Beispiele, wie andere KMU erfolgreich ihre CO2-Bilanzierung umgesetzt haben. Ziel ist es, den Einstieg in die Carbon Footprint-Berechnung zu erleichtern und aufzuzeigen, wie diese als strategisches Instrument für nachhaltiges Wirtschaften genutzt werden kann.
2.1 Was ist ein Carbon Footprint?
Ein Carbon Footprint misst die Klimawirkung in Form von Treibhausgasemissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Die Berechnung basiert auf dem Greenhouse Gas Protocol (GHG Protocol), dem weltweit am häufigsten verwendeten Standard zur Treibhausgasbilanzierung. Dabei werden alle relevanten Treibhausgase erfasst und mittels ihres Treibhauspotenzials (Global Warming Potential, GWP) in CO2-Äquivalente umgerechnet. Diese standardisierte Methodik ermöglicht es, verschiedene Emissionsquellen zu vergleichen und Reduktionspotenziale zu identifizieren.
2.2 Unterschied zwischen Unternehmens- und Produkt-Carbon-Footprint
Der „Corporate Carbon Footprint” (CCF) erfasst alle Treibhausgasemissionen eines gesamten Unternehmens innerhalb eines definierten Zeitraums, typischerweise eines Geschäftsjahres. Er umfasst direkte Emissionen aus eigenen Quellen (Scope 1), indirekte Emissionen aus eingekaufter Energie (Scope 2) und weitere indirekte Emissionen aus der Wertschöpfungskette (Scope 3). Der CCF dient als Grundlage für die Entwicklung einer unternehmensweiten Klimastrategie.
Der „Product Carbon Footprint” (PCF) hingegen bezieht sich auf ein spezifisches Produkt oder eine Dienstleistung und betrachtet dessen gesamten Lebensweg von der Rohstoffgewinnung über Produktion, Transport und Nutzung bis zur Entsorgung ("cradle-to-grave"). Der PCF wird zunehmend von Kunden nachgefragt und kann als Differenzierungsmerkmal im Wettbewerb dienen.
2.3 Relevante Treibhausgase
Für die Erstellung eines Carbon Footprints sind gemäß Kyoto-Protokoll sieben Haupttreibhausgase relevant:
| • | Kohlendioxid (CO2) als mengenmäßig bedeutsamstes Gas entsteht hauptsächlich bei der Verbrennung fossiler Brennstoffe. |
| • | Methan (CH4) mit einem 28-fach höheren Treibhauspotenzial als CO2 stammt vorwiegend aus Landwirtschaft und Abfallwirtschaft. |
| • | Lachgas (N2O), 265-mal klimawirksamer als CO2, wird primär durch Düngung und chemische Prozesse freigesetzt. |
| • | Die fluorierten Treibhausgase (F-Gase) umfassen teilfluorierte Kohlenwasserstoffe (HFCs), perfluorierte Kohlenwasserstoffe (PFCs), Schwefelhexafluorid (SF6) und Stickstofftrifluorid (NF3), die trotz geringer Mengen aufgrund ihres extrem hohen Treibhauspotenzials von bis zu 23.000 CO2-Äquivalenten bedeutsam sind. |
3.1 Aktuelle rechtliche Rahmenbedingungen
Die rechtliche Landschaft für Nachhaltigkeitsberichterstattung in Deutschland und Europa befindet sich im Umbruch. Seit Januar 2023 regelt die „Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD) die Pflicht zur Nachhaltigkeitsberichterstattung im Lagebericht für große Unternehmen mit mehr als 1.000 Mitarbeitenden. Ab 2026 müssen auch große nicht-börsennotierte Unternehmen berichten, die zwei der drei Kriterien erfüllen: mehr als 250 Mitarbeitende, 50 Millionen Euro Umsatz oder 25 Millionen Euro Bilanzsumme. KMU sind zunächst nur indirekt betroffen, wenn sie Teil der Lieferkette berichtspflichtiger Unternehmen sind.
Das deutsche „Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz” (LkSG) verpflichtet seit 2024 Unternehmen ab 1.000 Mitarbeitenden zur Einhaltung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten. Die Bundesregierung hat jedoch im September 2025 Erleichterungen beschlossen: Die Berichtspflichten werden ausgesetzt, und Bußgelder nur noch bei schweren Verstößen verhängt.
Die europäische „Corporate Sustainability Due Diligence Directive” (CSDDD) muss bis zum Juli 2027 im deutschen Rechtssystem verankert werden. Sie gilt ab 2028 zunächst für EU-Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten und 900 Millionen Euro Umsatz. Die CSDDD geht über das deutsche LkSG hinaus und fordert einen verpflichtenden Klimaplan zur Erreichung der Pariser Klimaziele.
3.2 Wie viele Unternehmen sind nach EU-Recht verpflichtet, CCF oder PCF abzugeben?
Bis Anfang 2025 wurde davon ausgegangen, dass durch die CSRD europaweit etwa 50.000 Unternehmen direkt berichtspflichtig werden, davon rund 15.000 in Deutschland. Zusätzlich wären über 10.000 Nicht-EU-Unternehmen mit signifikanten EU-Aktivitäten betroffen. Indirekt müssten jedoch weitaus mehr KMU Nachhaltigkeitsdaten liefern: Schätzungen gehen von bis zu 500.000 deutschen KMU aus, die als Zulieferer Informationen für die Scope-3-Berichterstattung ihrer Großkunden bereitstellen müssten. Doch auch diese Vorgaben werden kontinuierlich den Gegebenheiten der Märkte angepasst und es gibt einen Lichtblick für europäische KMUs: Im August 2025 wurde der neue freiwillige VSME-Standard (Voluntary SME Standard) von der EU-Kommission als Empfehlung veröffentlicht. Diese Leitlinien sollen im komplexen Verfahren Abhilfe schaffen und eine standardisierte, aber vereinfachte Berichterstattung für KMU ermöglichen.
Stand Oktober 2025 sieht es so aus, dass sich die Zahl der direkt berichtspflichtigen Unternehmen innerhalb Europas auf ca. 1/10 der 2024 geltenden Ausgangswerte reduziert. Es ist jedoch zu empfehlen, die diesbezüglichen rechtlichen Rahmenbedingungen im Blick zu behalten.
3.3 Wettbewerbsvorteile durch Nachhaltigkeit
Die frühzeitige Implementierung einer Carbon-Footprint-Berechnung verschafft KMU entscheidende Marktvorteile. Unternehmen mit transparenter Klimabilanz werden bei Ausschreibungen bevorzugt, da Großunternehmen zunehmend nachhaltige Lieferketten fordern. Banken vergeben günstigere Kredite an Unternehmen mit niedrigem CO2-Fußabdruck („Green Finance”). Zudem ermöglicht die systematische Erfassung von Emissionen die Identifikation von Einsparpotenzialen: Energieeffizienzmaßnahmen reduzieren nicht nur Emissionen, sondern senken auch Betriebskosten. Innovative, klimafreundliche Produkte erschließen neue Kundensegmente und rechtfertigen oft eine angepasste Preisgestaltung.
3.4 Einfluss auf das Unternehmensimage
Ein professionell kommunizierter Carbon Footprint stärkt die Unternehmensreputation erheblich. Studien zeigen, dass 73 % der Verbraucher bereit sind, mehr für nachhaltige Produkte zu zahlen. Besonders junge Fachkräfte der Generation Z wählen Arbeitgeber zunehmend nach Nachhaltigkeitskriterien aus. Die transparente Kommunikation von Klimazielen und -fortschritten schafft Vertrauen bei allen Stakeholdern. Allerdings ist Authentizität entscheidend: „Greenwashing” wird von kritischen Verbrauchern schnell entlarvt und kann zu erheblichen Reputationsschäden führen.
4.1 Methoden zur Berechnung
Die Berechnung des Carbon Footprints erfolgt nach international anerkannten Standards. Das GHG Protocol unterscheidet zwischen drei Berechnungsansätzen: Der aktivitätsbasierte Ansatz multipliziert Aktivitätsdaten (z. B. kWh Stromverbrauch) mit spezifischen Emissionsfaktoren. Der ausgabenbasierte Ansatz nutzt Finanzdaten und branchenspezifische Emissionsintensitäten. Der hybride Ansatz kombiniert beide Methoden für maximale Genauigkeit. Für KMU empfiehlt sich zunächst der aktivitätsbasierte Ansatz für Scope 1 und 2, ergänzt um ausgabenbasierte Schätzungen für Scope 3.