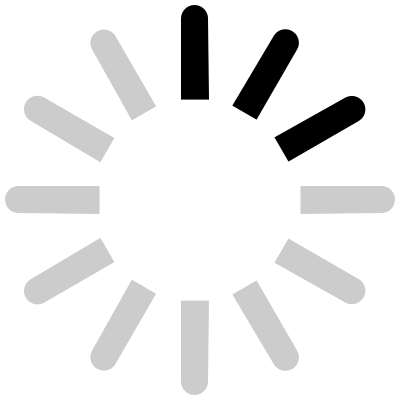07207 Nachhaltige Produktion und Klimareporting – Ökobilanzierung als wirksamer Hebel für Klimaschutz
|
Erfahren Sie in diesem Beitrag, wie Unternehmen mithilfe der Ökobilanzierung ihre Treibhausgasemissionen analysieren und reduzieren können, um die Klimaziele der EU und Deutschlands zu erreichen.
Die Ökobilanz schafft Transparenz über die Auswirkungen von Produktionsprozessen auf das Klima. Ein Energiemanagement nach ISO 50001 oder EMAS dient als Grundlage für das Klimareporting und erfasst direkte (Scope 1) und indirekte Emissionen (Scope 2) aus Brennstoffen und zugekauftem Strom. Ein besonderes Augenmerk liegt auf den Scope-3-Emissionen entlang der Wertschöpfungskette – sie sind schwerer zu erfassen, machen jedoch oft den Großteil der Emissionen aus. von: |
1 Einführung
Sowohl die EU als auch Deutschland haben sich ehrgeizige Klimaschutzziele gesetzt. Das im Klimaschutzplan 2050 festgelegte Ziel der Bundesregierung ist es, den Primärenergieverbrauch bis 2020 um 20 % und bis 2050 um 50 % zu senken und die Treibhausgas(THG)-Emissionen
| • | bis 2020 um 40 % gegenüber 1990, |
| • | bis 2030 um 55 %, |
| • | bis 2040 um 70 % und |
| • | bis 2050 um 80 % |
zu reduzieren. Bis 2050 soll der Anteil erneuerbarer Energien bei 60 % und bei der Stromerzeugung bei 80 % liegen [1]. Die Ampelkoalition hat diese Ziele weiter verschärft. So sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 % und bis 2040 um 88 % gegenüber 1990 gesenkt werden. Bis 2045 soll Klimaneutralität erreicht werden [2]. Dies erfordert enorme Anstrengungen in allen Sektoren.
Diese Anstrengungen manifestieren sich auf politischer Seite in der Neufassung der Richtlinie (EU) 2022/2464 über die Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unternehmen, die „Corporate Sustainability Reporting Directive” (CSRD). Diese ist seit Anfang 2023 in Kraft und muss von den EU-Mitgliedstaaten bis Mitte 2024 in nationales Recht umgesetzt werden.
Die dort spezifizierte Berichtspflicht wird phasenweise von den bereits berichtspflichtigen Unternehmen auf alle bilanzrechtlich großen Unternehmen sowie alle börsennotierten Unternehmen ausgeweitet:
| • | Geschäftsjahr 2024: bisher zur Abgabe einer nichtfinanziellen Erklärung verpflichtete Unternehmen |
| • | Geschäftsjahr 2025: alle weiteren großen Unternehmen |
| • | Geschäftsjahr 2026: börsennotierte kleine und mittlere Unternehmen (mit Ausnahme von Kleinstunternehmen), kleine und nicht komplexe Kreditinstitute und firmeneigene Versicherungsunternehmen |
| • | Geschäftsjahr 2028: Unternehmen aus Drittländern mit einem Nettoumsatz von über 150 Mio. EUR in der EU, wenn sie mindestens ein Tochterunternehmen oder eine Zweigniederlassung in der EU haben und bestimmte Schwellenwerte überschreiten [3]. |
Die konkreten Berichtsanforderungen werden in Nachhaltigkeitsberichtsstandards definiert, den „European Sustainability Reporting Standards” (ESRS). Diese hat die Europäische Kommission im Juli 2023 als delegierten Rechtsakt verabschiedet. Branchenspezifische Standards sollen später folgen.
Ein wesentlicher Themenbereich sind die Anforderungen zu Klimaschutz, Klimaanpassung und Energie (ESRS E2), im Folgenden Klimareporting genannt. Es ist daher notwendig, den Stakeholdern das notwendige Hintergrundwissen zu vermitteln, mit dem sie möglichst realistisch einschätzen können, welchen Einfluss die wirtschaftlichen Aktivitäten eines Unternehmens über den Energie- und Ressourcenverbrauch auf das Klima haben und wie effektiv eigene, getroffene Maßnahmen sein können, um diesen Einfluss zu verringern.
Eine wesentliche Rolle spielen dabei die Treibhausgase.
2 Treibhausgasemissionen in der Produktion
Die realen Treibhausgasemissionen eines Produktionsbetriebs sowie deren Wirkungen auf die Umwelt sind zunächst unbekannt oder können, zumindest die CO2-Emissionen, höchstens aufgrund des Energiebedarfs bzw. -verbrauchs grob abgeschätzt werden. Dieser besteht aus dem Verbrauch von Strom, Kraftstoffen sowie Raum- und Prozesswärme, die wiederum aus fossilen oder nachwachsenden Rohstoffen erzeugt werden.
Sowohl für die Stromerzeugung als auch für die Verbrennung fossiler Energieträger zur Wärmeerzeugung und als Treibstoff sind die dabei freiwerdenden spezifischen CO2-Emissionen bekannt (s. Tab. 2 und Tab. 3). Damit können die jährlichen CO2-Emissionen über den Energieverbrauch des Unternehmens berechnet werden.
Lösungsmöglichkeit
Durch die systematische Erfassung der Energie- und Stoffströme der Produktion sowie der vor- und nachgelagerten Prozesse können mit Hilfe einer Ökobilanz die Emissionen eines Industriebetriebs transparent gemacht und die Auswirkungen auf Klima, Boden und Gewässer abgeschätzt werden.
Durch die systematische Erfassung der Energie- und Stoffströme der Produktion sowie der vor- und nachgelagerten Prozesse können mit Hilfe einer Ökobilanz die Emissionen eines Industriebetriebs transparent gemacht und die Auswirkungen auf Klima, Boden und Gewässer abgeschätzt werden.
Um die verbrauchsbedingten Emissionen zu senken, könnte man jetzt einfach beschließen, einen bestimmten Prozentsatz des Stromverbrauchs, des Wärmeverbrauchs und des Kraftstoffverbrauchs einzusparen. Dies lässt sich insbesondere durch das Nutzerverhalten, die energietechnische Optimierung von Maschinen und Anlagen, steuerungs- und regelungstechnische Maßnahmen sowie bauliche Optimierungen realisieren.
Was ist zu berücksichtigen?
Eine solche Entscheidung darf jedoch die wirtschaftliche Aktivität des Unternehmens nicht beeinträchtigen, d. h. es dürfen keine zu hohen Investitionen zur Erreichung dieses Einsparziels getätigt werden. Ebensowenig darf der Komfort der Mitarbeitenden (Klimatisierung, Lüftung) zu sehr eingeschränkt werden, da dies deren Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen kann.
Eine solche Entscheidung darf jedoch die wirtschaftliche Aktivität des Unternehmens nicht beeinträchtigen, d. h. es dürfen keine zu hohen Investitionen zur Erreichung dieses Einsparziels getätigt werden. Ebensowenig darf der Komfort der Mitarbeitenden (Klimatisierung, Lüftung) zu sehr eingeschränkt werden, da dies deren Leistungsfähigkeit negativ beeinflussen kann.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, welche Möglichkeiten das Unternehmen auf der Seite von Rohstoffen und Vorprodukten hat, seine CO2-Emissionen nachhaltig zu senken, ohne die operativen oder wirtschaftlichen Ziele zu gefährden.
3 Treibhausgase und ihre Erfassung
Treibhausgase sind gasförmige Stoffe, die einen Teil der von der Erde abgegebenen langwelligen Wärmestrahlung absorbieren und so die Atmosphäre erwärmen. Die Emissionen aus natürlichen Quellen haben dazu geführt, dass die Erdoberfläche eine mittlere Temperatur von 15°C hat. Ohne diesen Effekt läge die mittlere Temperatur auf der Erdoberfläche bei -18°C. Die übermäßige Emission aus künstlichen Quellen führt zu Klimaerwärmung bzw. -veränderungen.
Die wichtigsten Treibhausgase sind in Tabelle 1 zusammengefasst.
Treibhausgas | Chemische Formel | Verweilzeit Atmosphäre | GWP 100 |
CO2 | CO2 | unterschiedlich | 1 |
Methan | CH4 | 12 ± 3 Jahre | 25 |
Lachgas | N2O | 120 Jahre | 298 |
Schwefelhexafluorid | SF6 | 3200 Jahre | 22800 |
Kältemittel | 1–265 Jahre | 0–15000 | |
Ammoniak | NH3 | 0 | |
R-12 | CCl2F2 | 10900 | |
R 22 | CHClF2 | 1810 | |
R-134a | Blend | 1430 | |
R-407C | Blend | 1740 | |
R 404A | Blend | 3920 |
GWP 100
Dabei bedeutet „GWP 100” (Global Warming Potential) das auf CO2 normierte Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre über einen Zeithorizont von 100 Jahren. 1kg Methan hat demzufolge eine 25-fach stärkere Wirkung als 1kg CO2. Man drückt dies auch aus, indem man von 25 CO2-Äquivalenten spricht.
Dabei bedeutet „GWP 100” (Global Warming Potential) das auf CO2 normierte Potenzial zur Erwärmung der Atmosphäre über einen Zeithorizont von 100 Jahren. 1kg Methan hat demzufolge eine 25-fach stärkere Wirkung als 1kg CO2. Man drückt dies auch aus, indem man von 25 CO2-Äquivalenten spricht.
Weltweit ist es daher eine zwingende Notwendigkeit und auch anerkannter politischer Wille, den Ausstoß von Treibausgasen umfassend zu verringern. Die meisten Staaten haben entsprechende Vorgaben formuliert und versuchen, diese umzusetzen.
Unterscheidung nach Scopes
Die Treibhausgas-Emissionen werden unterschieden nach sogenannten Scopes [6]:
Die Treibhausgas-Emissionen werden unterschieden nach sogenannten Scopes [6]:
| Scope 1: | Direkte Emissionen aus der Verbrennung von Brennstoffen und Kraftstoffen für betriebliche Zwecke |
| Scope 2: | Emissionen aus Produkten wie Strom, Fernwärme, Fernkälte oder Dampf, die für Unternehmenszwecke eingekauft werden |
| Scope 3: | Emissionen aus eingekauften Dienstleistungen, gekauften oder geleasten Kapitalgütern, Roh- und Hilfsstoffen, Abfallbehandlung, Geschäftsreisen, Pendelverkehr der Mitarbeitenden, Nutzungsphase und Recycling der erzeugten Produkte oder Logistikleistungen von Fremdfirmen im Auftrag des Unternehmens |
Mithilfe der verschiedenen Scopes können Unternehmen auch die indirekten Treibhausgasemissionen im Blick haben, die den eigenen Wertschöpfungsketten vor- oder nachgelagert sind.
Abb. 1: Scopes nach dem GHG(Greenhouse Gas)-Protokoll [6]
Ein belastbares Klima-Reporting erfordert die systematische Erfassung und Bewertung der oben genannten Emissionen. Da ein Großteil der Emissionen auf den direkten oder indirekten Verbrauch von Brennstoffen und daraus hergestellten Produkten zurückzuführen ist, bietet es sich an, in einem ersten Schritt ein Energiemanagement, idealerweise ein Energiecontrolling, als Grundlage für das Klimareporting einzuführen. Mit anderen Worten: Verfügt ein Unternehmen über ein funktionierendes Energiemanagementsystem (oder ein Umweltmanagementsystem nach EMAS), kann es mit geringem Mehraufwand ein belastbares Klimareporting durchführen.
Dies funktioniert allerdings nur für die Scope 1- und Scope-2-Emissionen, also die direkten Emissionen aus der Verbrennung von Brenn- und Treibstoffen sowie die indirekten Emissionen, die außerhalb des Unternehmens bei der Erzeugung von Strom oder Wärme/Dampf entstehen.
Scope-3-Emissionen schwer zu erfassen
Scope 3 Emissionen, wie sie z. B. bei der Gewinnung, der Verarbeitung und dem Transport von Rohstoffen entstehen, sind über das Energiecontrolling nur schwer zu erfassen, da viele der Produktion vor- und nachgelagerte Prozesse nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erfasst werden können. Zudem ist man hier auf Informationen der Lieferanten angewiesen.
Scope 3 Emissionen, wie sie z. B. bei der Gewinnung, der Verarbeitung und dem Transport von Rohstoffen entstehen, sind über das Energiecontrolling nur schwer zu erfassen, da viele der Produktion vor- und nachgelagerte Prozesse nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand erfasst werden können. Zudem ist man hier auf Informationen der Lieferanten angewiesen.
Gerade bei Scope-3-Emissionen müssen die Anstrengungen verstärkt werden, da sie bis zu über 80 % der Gesamtemissionen eines Unternehmens ausmachen können.
4 EnMS oder EMAS als Grundlage des Klimareportings
Die Grundlage für das Klimareporting ist die Transparenz des Energieverbrauchs (Strom, Brennstoffe, Kraftstoffe) in der Wertschöpfungskette. Diese gewinnt man durch ein entsprechend angelegtes Energiemanagementsystem, das in Deutschland überwiegend nach EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) oder der DIN EN ISO 50001 gestaltet ist.