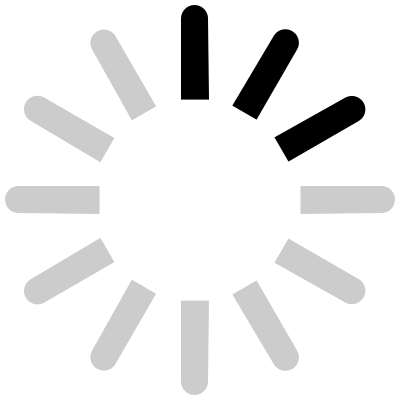07017 Klimamanagement in Organisationen
|
Seit dem Pariser Abkommen aus dem Jahr 2016 ist klar: Auch Organisationen wie Unternehmen, Hochschulen oder die öffentliche Verwaltung müssen ihre Treibhausgasemissionen (THG) so schnell wie möglich reduzieren und Mitte des Jahrhunderts zumindest bilanziell keine THG mehr ausstoßen, um das 2°C-Ziel einzuhalten. In diesem Artikel erfahren Sie, warum eine Auseinandersetzung mit dem Thema Klimamanagement aufgrund aktueller Entwicklungen für Sie interessant ist und welche Schritte Sie gehen müssen, um ein effektives Klimamanagement in Ihrer Organisation umzusetzen. Wir beleuchten dabei nicht nur die Theorie, sondern analysieren auch aufkommende Probleme und geben kleine Praxisbeispiele zur Verdeutlichung. von: |
1 Klimamanagement und Klimaneutralität
Der Begriff Klimamanagement ist kein geschützter Begriff mit fester Definition. Unternehmerisches Klimamanagement zielt grundsätzlich auf Aktivitäten zum Umgang mit Risiken und relevanten Quellen von Treibhausgasemissionen (THG) am Standort sowie auf vor- und nachgelagerte Aktivitäten entlang der Wertschöpfungskette ab.
Kernpunkte Klimamanagement
Folgende Kernpunkte werden beim Klimamanagement betrachtet:
Folgende Kernpunkte werden beim Klimamanagement betrachtet:
| • | Identifikation
| ||||||||
| • | Erfassung
| ||||||||
| • | Bewertung
| ||||||||
| • | Ziele
| ||||||||
| • | Maßnahmen
|
Klimaneutralität
Ein aktives und fortlaufendes Klimamanagement kann zur Klimaneutralität und Klimaresilienz führen. Klimaneutralität bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch, dass für einen bestimmten Zeitraum – etwa das Vorjahr – alle verursachten Treibhausgasemissionen bilanziell ausgeglichen werden, indem Maßnahmen ergriffen werden, die zur Minderung des Ausstoßes, zur Beseitigung oder Entnahme der Gase aus der Atmosphäre führen. Wissenschaftliche Definitionen, wie etwa des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), beschreiben Klimaneutralität als einen Zustand, bei dem jegliche menschliche Aktivitäten keinen Nettoeffekt auf das Klimasystem verursachen (s. Abb. 1). Zu diesen Aktivitäten gehören neben dem Ausstoß von Treibhausgasen (THG) auch Aerosole sowie die Veränderung von anderen klima-beeinflussenden Effekten (z. B. der Albedo-Effekt) sowie regionale oder lokale biogeophysikalische Effekte (z. B. lokaler Wasserdampfausstoß durch Kraftwerke) [1].
Ein aktives und fortlaufendes Klimamanagement kann zur Klimaneutralität und Klimaresilienz führen. Klimaneutralität bedeutet im allgemeinen Sprachgebrauch, dass für einen bestimmten Zeitraum – etwa das Vorjahr – alle verursachten Treibhausgasemissionen bilanziell ausgeglichen werden, indem Maßnahmen ergriffen werden, die zur Minderung des Ausstoßes, zur Beseitigung oder Entnahme der Gase aus der Atmosphäre führen. Wissenschaftliche Definitionen, wie etwa des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), beschreiben Klimaneutralität als einen Zustand, bei dem jegliche menschliche Aktivitäten keinen Nettoeffekt auf das Klimasystem verursachen (s. Abb. 1). Zu diesen Aktivitäten gehören neben dem Ausstoß von Treibhausgasen (THG) auch Aerosole sowie die Veränderung von anderen klima-beeinflussenden Effekten (z. B. der Albedo-Effekt) sowie regionale oder lokale biogeophysikalische Effekte (z. B. lokaler Wasserdampfausstoß durch Kraftwerke) [1].