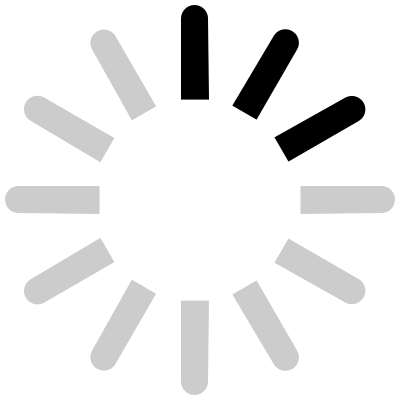05002 Straftaten gegen die Umwelt
|
Geschütztes Rechtsgut ist die Umwelt als Ganzes, jedoch nicht um ihrer selbst willen, sondern in ihren Medien, in Boden, Luft und Wasser, sowie ihren Erscheinungsformen in der Tier- und Pflanzenwelt. Bereits hier ergeben sich interessante Parallelen zum Umweltmanagement, denn auch dort geht es um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch nachhaltige Entwicklung. Dieser Beitrag gibt in Kürze einen Überblick, welche Straftatbestände gegen die Umwelt es gibt und wie die Verantwortlichkeiten im Unternehmen geregelt werden sollten. von: |
1 Einführung
Das Umweltschutzstrafrecht ist geregelt im 29. Abschnitt des Strafgesetzbuches (StGB), dort konkret in den §§ 324 bis 330d StGB. Geschütztes Rechtsgut ist die Umwelt als Ganzes, jedoch nicht um ihrer selbst willen, sondern in ihren Medien, in Boden, Luft und Wasser, sowie ihren Erscheinungsformen in der Tier- und Pflanzenwelt.
Sie ist eigenständiges Rechtsgut nur in Bezug auf das gegenwärtige und zukunftsorientierte menschliche Interesse an der Erhaltung humaner Umweltbedingungen (ökologisch-anthropozentrische Rechtsgutauffassung), insbesondere des naturschutzrechtlichen Schutzzwecks der Rechtsvorschriften und Untersagungen, die sich auf den – im StGB selbst nicht mehr verwendeten – Begriff des „Naturhaushalts” beziehen, um das gesetzgeberische Interesse an der Erhaltung des Artenreichtums im Interesse des ökologischen Gleichgewichts der Natur zu verdeutlichen.
Parallelen zwischen StGB und UMS
Bereits hier ergeben sich interessante Parallelen zum Umweltmanagement, denn auch dort geht es um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch nachhaltige Entwicklung. Während es im Umweltstrafrecht hauptsächlich repressive Ansätze gibt, befassen sich Umweltmanagementsysteme mit der zentralen Zielsetzung einer kontinuierlichen Verbesserung nachteiliger Umweltauswirkungen.
Bereits hier ergeben sich interessante Parallelen zum Umweltmanagement, denn auch dort geht es um die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen durch nachhaltige Entwicklung. Während es im Umweltstrafrecht hauptsächlich repressive Ansätze gibt, befassen sich Umweltmanagementsysteme mit der zentralen Zielsetzung einer kontinuierlichen Verbesserung nachteiliger Umweltauswirkungen.
Eine weitere Besonderheit, auf die später noch näher eingegangen wird, ist die so genannte „Verwaltungsrechtsakzessorietät” des Umweltstrafrechts. So ist eine „Gewässerverunreinigung” nur strafbar, wenn sie „unbefugt” erfolgt. In anderen Fällen, wie z. B. der „Bodenverunreinigung”, kommt eine Strafbarkeit nur in Betracht, wenn eine „Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflichten” vorliegt. Schließlich gibt es auch Fälle, in denen die „Verletzung verwaltungsrechtlicher Pflicht” allein den Tatbestand ausmacht, wie z. B. beim Betreiben einer Anlage ohne die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz erforderliche Genehmigung.
Umweltverwaltungsrecht beachten
Das Umweltstrafrecht steht demnach in engem Zusammenhang mit der Beachtung des Umweltverwaltungsrechts durch das Unternehmen. Genau dasselbe Ziel verfolgt die DIN EN ISO 14001 oder EMAS III (Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG), wonach sich die Unternehmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften verpflichten. Entsprechend dieser Verpflichtung muss das Unternehmen ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen einführen, verwirklichen und aufrechterhalten. Die Ergebnisse dieser Bewertung sind zu dokumentieren und aufzubewahren.
Das Umweltstrafrecht steht demnach in engem Zusammenhang mit der Beachtung des Umweltverwaltungsrechts durch das Unternehmen. Genau dasselbe Ziel verfolgt die DIN EN ISO 14001 oder EMAS III (Verordnung (EG) Nr. 1221/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 25. November 2009 über die freiwillige Teilnahme von Organisationen an einem Gemeinschaftssystem für Umweltmanagement und Umweltbetriebsprüfung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 761/2001, sowie der Beschlüsse der Kommission 2001/681/EG und 2006/193/EG), wonach sich die Unternehmen zur Einhaltung der Rechtsvorschriften verpflichten. Entsprechend dieser Verpflichtung muss das Unternehmen ein Verfahren zur regelmäßigen Bewertung der Einhaltung der einschlägigen rechtlichen Verpflichtungen einführen, verwirklichen und aufrechterhalten. Die Ergebnisse dieser Bewertung sind zu dokumentieren und aufzubewahren.
Logischerweise setzt diese Verpflichtung zunächst voraus, dass die relevanten Rechtsvorschriften ermittelt werden. Die EMAS fordert die Erstellung eines Verzeichnisses der geltenden rechtlichen Verpflichtungen. Diese sind dann kontinuierlich zu verfolgen, d. h. Änderungen sind auf Relevanz für das Unternehmen zu prüfen. Gegebenenfalls resultiert aus einer gesetzlichen Änderung auch das Erfordernis betriebliche Vorgehensweisen und Prozesse anzupassen.
Nach dem oben Gesagten kann bereits jetzt der Schluss gezogen werden: Je besser der Standort die Verpflichtung zur Ermittlung und Umsetzung der umweltrechtlichen Vorschriften betreibt, desto geringer muss das Risiko sein, wegen vom (Umwelt-)Verwaltungsrecht abhängiger Strafvorschriften verurteilt zu werden.
2 Die Straftatbestände
Die Straftatbestände zum Schutz der Umwelt sind hauptsächlich geregelt in den §§ 324 bis 330d StGB. Im Einzelnen sind dies
| • | die Gewässerverunreinigung, § 324 StGB, |
| • | die Bodenverunreinigung, § 324a StGB, |
| • | die Luftverunreinigung, § 325 StGB, |
| • | die Verursachung von Lärm etc., § 325a StGB, |
| • | der unerlaubte Umgang mit Abfällen, § 326 StGB, |
| • | das unerlaubte Betreiben von Anlagen, § 327 StGB, |
| • | der unerlaubte Umgang mit radioaktiven Stoffen und anderen gefährlichen Stoffen/Gütern und |
| • | die Gefährdung schutzbedürftiger Gebiete, § 329 StGB |
| • | die schwere Gefährdung durch Freisetzen von Giften, § 330a. |
Neben dem StGB finden sich in den jeweiligen Fachgesetzen strafrechtliche Vorschriften, so etwa in
| • | § 27 Chemikaliengesetz (ChemG), |
| • | §§ 71 und 71a Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG), |
| • | § 11 Gefahrgutbeförderungsgesetz (GGBefG). |
Spitzenreiter: gefährliche Abfälle
Absoluter „Spitzenreiter” der Umweltstraftaten ist laut Statistik des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2021 § 326 StGB, der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen, gefolgt von der Gewässerverunreinigung, § 324 StGB und der Bodenverunreinigung, § 324a StGB.
Absoluter „Spitzenreiter” der Umweltstraftaten ist laut Statistik des Bundeskriminalamtes für das Jahr 2021 § 326 StGB, der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen, gefolgt von der Gewässerverunreinigung, § 324 StGB und der Bodenverunreinigung, § 324a StGB.
Abfallerzeuger ist verantwortlich
Der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen, § 326 StGB, betrifft häufig die Entsorgungsfirmen, die Abfälle transportieren, mit Abfällen makeln, diese verwerten oder beseitigen. Diese Handlungen werden in der Regel von produzierenden Betrieben nicht selbst ausgeführt, sondern hierfür wird ein meist nach der EntsorgungsfachbetriebeVO zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb beauftragt. Dennoch ist das Unternehmen als Abfallerzeuger für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nach den Grundsätzen der Delegation (siehe unten) verantwortlich.
Der unerlaubte Umgang mit gefährlichen Abfällen, § 326 StGB, betrifft häufig die Entsorgungsfirmen, die Abfälle transportieren, mit Abfällen makeln, diese verwerten oder beseitigen. Diese Handlungen werden in der Regel von produzierenden Betrieben nicht selbst ausgeführt, sondern hierfür wird ein meist nach der EntsorgungsfachbetriebeVO zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb beauftragt. Dennoch ist das Unternehmen als Abfallerzeuger für die ordnungsgemäße Entsorgung der Abfälle nach den Grundsätzen der Delegation (siehe unten) verantwortlich.
Tatgegenstand des § 326 StGB sind Abfälle, wobei mangels einer eigenständigen Definition der strafrechtliche Abfallbegriff in Anlehnung an den verwaltungsrechtlichen Begriff des § 3 KrWG zu bestimmen ist. Die Abfälle müssen des Weiteren allerdings eine gewisse Qualität der besonderen Gefährlichkeit aufweisen, wie nach Art, Beschaffenheit oder Menge geeignet sein, nachhaltig ein Gewässer, die Luft oder den Boden zu verunreinigen oder sonst nachteilig zu verändern. In Betracht zu ziehen sind hierbei insbesondere die gefährlichen Abfälle. Aufschluss über die Gefährlichkeitseinstufung eines Abfalls gibt die Abfallverzeichnis-Verordnung (AVV).
Die Handlung des Täters muss, wie auch bei der Gewässerverunreinigung, § 324 StGB, unbefugt erfolgen. Hierin drückt sich u. a. die Verwaltungsrechtsakzessorietät des Strafrechts aus. Es soll strafrechtlich nicht sanktioniert werden, was seitens der Exekutive erlaubt wurde. Ist die Handlung behördlicherseits erlaubt oder sonst gerechtfertigt, scheidet eine Verwirklichung der Straftatbestände demnach aus.
Das Vorliegen einer behördlichen Erlaubnis ist relativ einfach zu prüfen, während das die Tathandlung rechtfertigende, behördliche Dulden in der Prüfung zumeist Schwierigkeiten bereitet. Zwar gelten für § 324 StGB und § 326 StGB nicht exakt dieselben Grundsätze, dennoch soll an dieser Stelle zumindest auf die Auffassung der Rechtsprechung kurz eingegangen werden.
3 Die behördliche Duldung
Die behördliche Duldung hat nach Auffassung des Bundesgerichtshofs – BGH – grundsätzlich keine genehmigungsgleiche oder rechtfertigende Wirkung. Das ist in den Fällen schlichter Duldung im Sinne bloßen Untätigbleibens der Behörde allgemeine Meinung. Hingegen werden Fälle der aktiven Duldung, in denen die Behörde z. B. in schwebenden Genehmigungsverfahren ein Verhalten oder einen bestimmten Zustand bewusst hinnimmt, als gerechtfertigt im Sinne einer konkludent erklärten Erlaubnis angesehen.