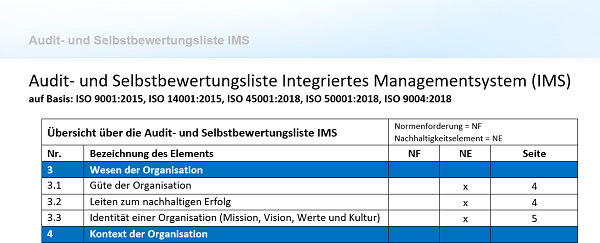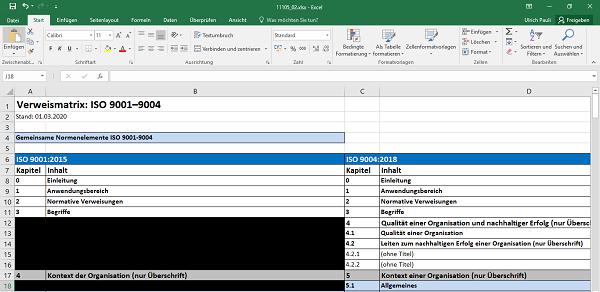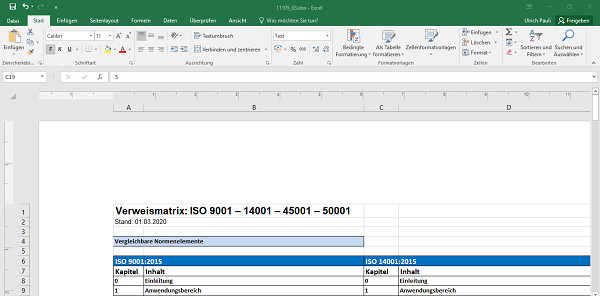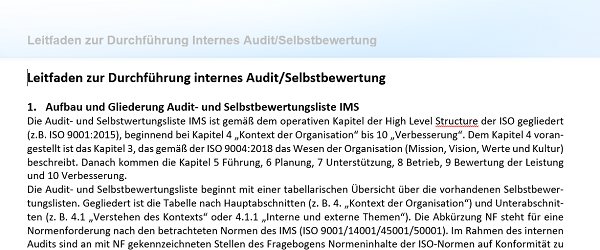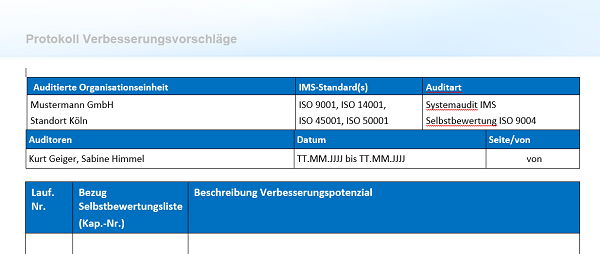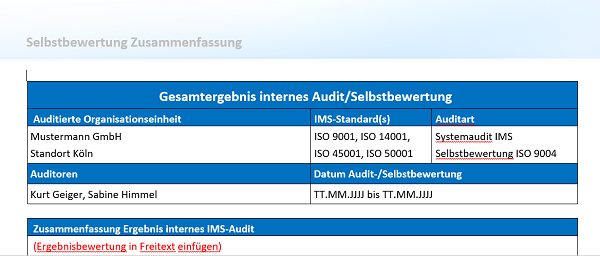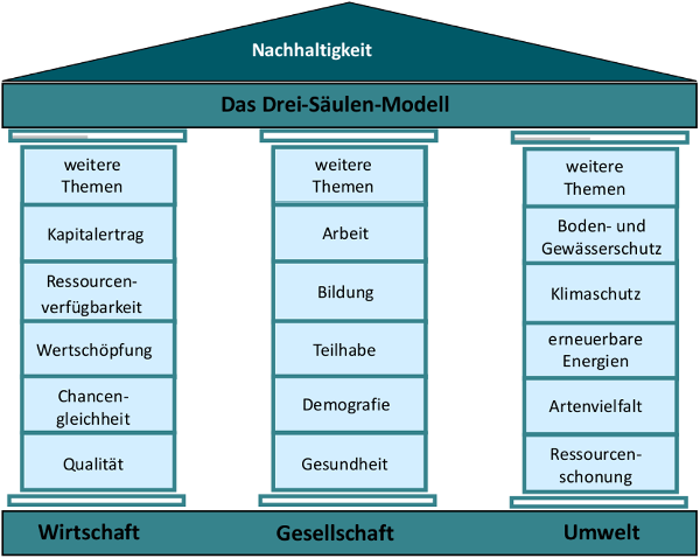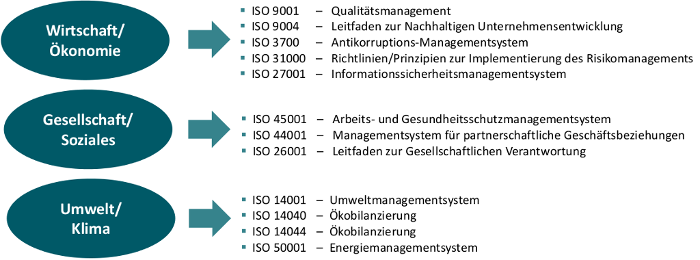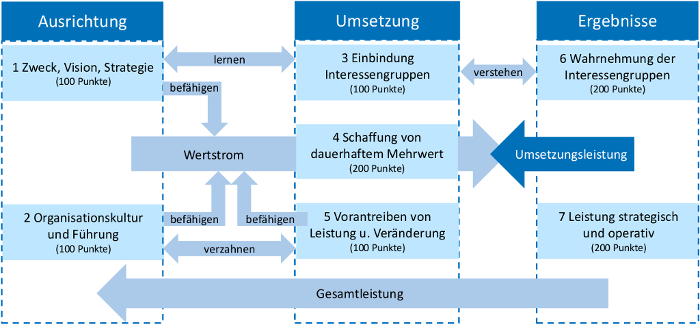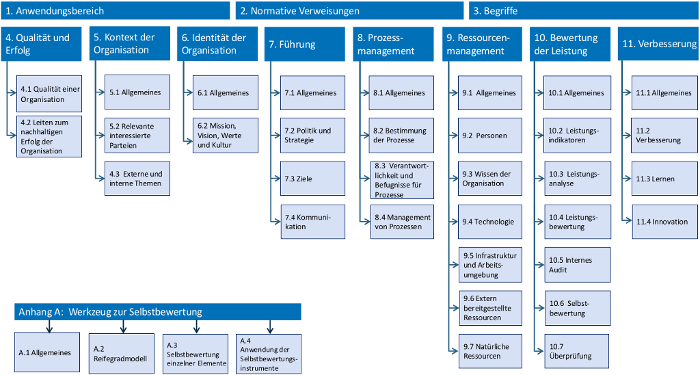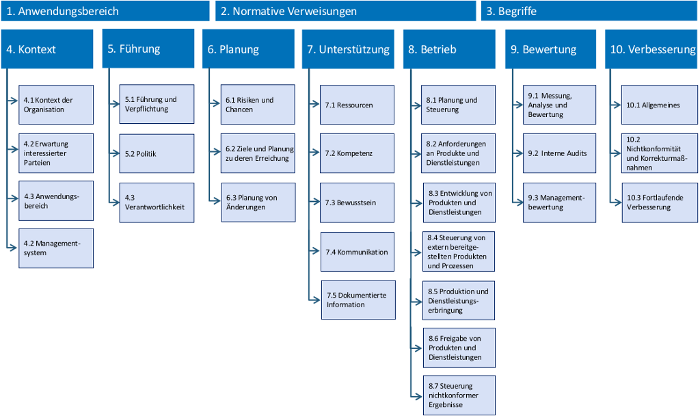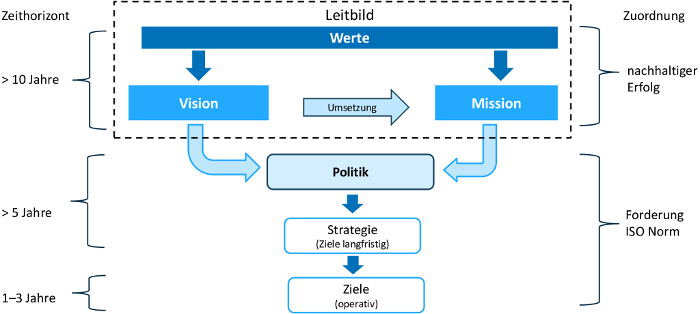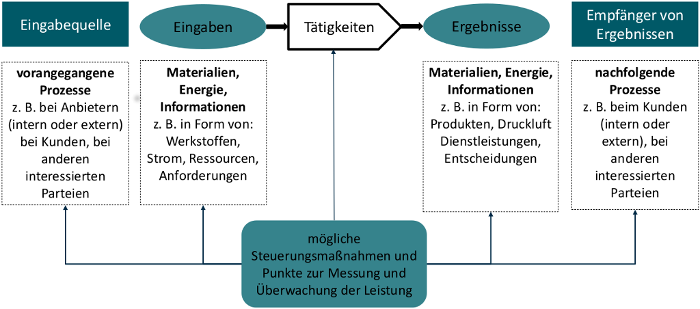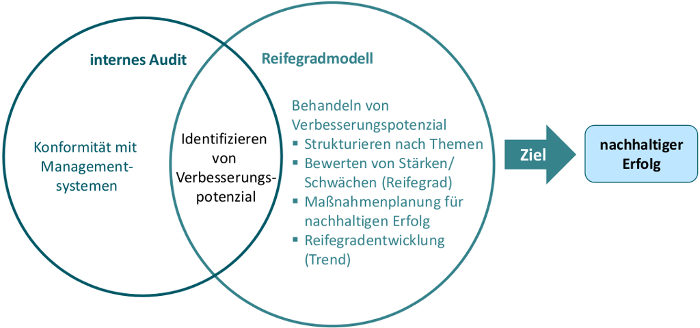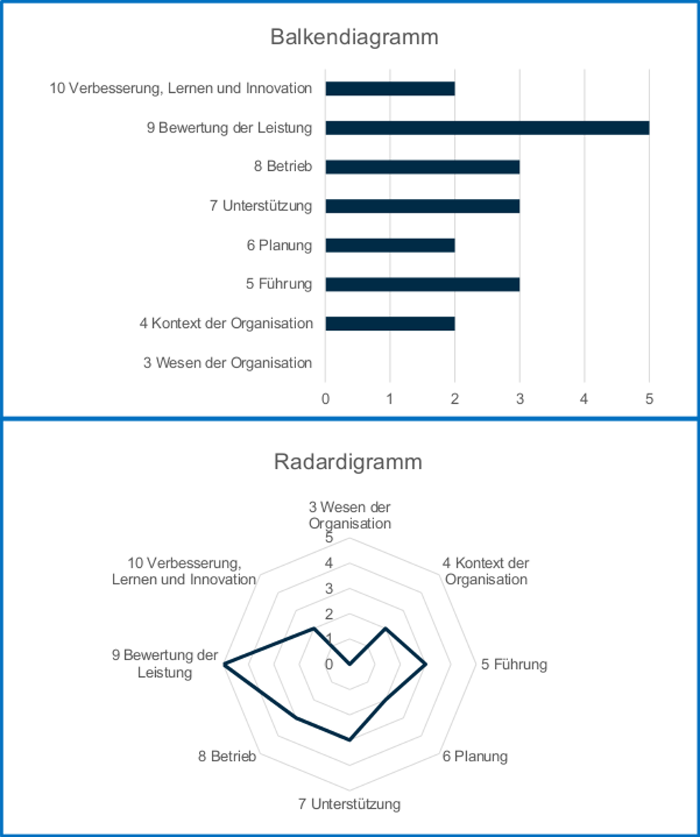06304 Integrierte Managementsysteme
Schritte zum nachhaltigen Erfolg
|
Am Beispiel der Normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 wird gezeigt, wie Sie durch integrierte Systeme Ihr eigenes Unternehmen erfolgreich und effizient in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.
Der Leitfaden ISO 9004 „Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” bietet einen Ansatz zur messbaren Selbstbewertung, der über QM hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung findet. Dazu werden die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß seinem Reifegradmodell herangezogen.
Zur Überwachung der Leistung des Managementsystems wird das interne Audit nach der ISO 19011 herangezogen. Dabei ist die Erfüllung der Mindestanforderungen Prüfgegenstand: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?
Die Integration beider Ansätze bietet Ihnen die Möglichkeit zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines umfangreichen Selbstbewertungskatalogs sowie weiteren notwendigen dokumentierten Informationen. Arbeitshilfen: von: |
1 Nachhaltigkeit und Managementsysteme
Einstieg
Integrierte Systemaudits sind in der Praxis für immer mehr Unternehmen Bestandteil ihrer Managementsysteme. In diesem Beitrag erfahren Sie am Beispiel der Normen ISO 9001 [1], ISO14001 [2], ISO 45001 [3] und ISO 50001 [4], wie Sie über integrierte Systeme erfolgreich und effizient das eigene Unternehmen in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.
Integrierte Systemaudits sind in der Praxis für immer mehr Unternehmen Bestandteil ihrer Managementsysteme. In diesem Beitrag erfahren Sie am Beispiel der Normen ISO 9001 [1], ISO14001 [2], ISO 45001 [3] und ISO 50001 [4], wie Sie über integrierte Systeme erfolgreich und effizient das eigene Unternehmen in Richtung nachhaltige Unternehmensentwicklung steuern können.
Basis ISO 9004
Dazu bietet der Leitfaden ISO 9004 [5]„Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” mit seiner Methodik zur messbaren Selbstbewertung einen Ansatz, der über das Qualitätsmanagement hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung finden kann. Die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß dem Reifegradmodel in der ISO 9004 bilden eine abgestufte Messbarkeit des erreichten Qualitätslevels des Unternehmens.
Dazu bietet der Leitfaden ISO 9004 [5]„Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs” mit seiner Methodik zur messbaren Selbstbewertung einen Ansatz, der über das Qualitätsmanagement hinaus auch auf andere Managementsysteme integrativ Anwendung finden kann. Die fünf Stufen der Selbstbewertung gemäß dem Reifegradmodel in der ISO 9004 bilden eine abgestufte Messbarkeit des erreichten Qualitätslevels des Unternehmens.
... und ISO 19011
Als weiteres Modell zur Überwachung der Leistung eines Managementsystems gilt in der Praxis das interne Audit nach der ISO 19011 [6] „Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen”. Bei internen Audits ist die Erfüllung der zu prüfenden Managementsystemnorm hinsichtlich der Mindestanforderungen Prüfgegenstand. Dabei gibt es im Grundsatz nur die Einstufung in zwei Klassen: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?
Als weiteres Modell zur Überwachung der Leistung eines Managementsystems gilt in der Praxis das interne Audit nach der ISO 19011 [6] „Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen”. Bei internen Audits ist die Erfüllung der zu prüfenden Managementsystemnorm hinsichtlich der Mindestanforderungen Prüfgegenstand. Dabei gibt es im Grundsatz nur die Einstufung in zwei Klassen: Ist die Normforderung erfüllt oder nicht erfüllt?
Integriertes Bewertungsverfahren
Eine Integration dieser beiden Bewertungsverfahren in ein gemeinsames Bewertungsverfahren ist notwendig, um der Forderung der Managementsysteme nach internen Audits auf der einen Seite und der Messbarkeit des Reifegrads auf dem Wege zur Best Practice in der Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite zu entsprechen.
Eine Integration dieser beiden Bewertungsverfahren in ein gemeinsames Bewertungsverfahren ist notwendig, um der Forderung der Managementsysteme nach internen Audits auf der einen Seite und der Messbarkeit des Reifegrads auf dem Wege zur Best Practice in der Nachhaltigkeit, auf der anderen Seite zu entsprechen.
Neu gestalteter Auditprozess
Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Grundsätzen der ISO 9004 und der ISO 19011 und stellen Ihnen Möglichkeiten vor für eine neue Gestaltung des Auditprozesses zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines Selbstbewertungskatalogs und weiteren notwendigen dokumentierten Informationen.
Die folgenden Ausführungen beruhen auf den Grundsätzen der ISO 9004 und der ISO 19011 und stellen Ihnen Möglichkeiten vor für eine neue Gestaltung des Auditprozesses zur Durchführung von integrierten Systemaudits unter der Maßgabe einer messbaren nachhaltigen Unternehmensentwicklung. Wir unterstützen Sie dabei mit Arbeitshilfen in Form eines Selbstbewertungskatalogs und weiteren notwendigen dokumentierten Informationen.
1.1 Allgemeines
Erfolgsfaktor Nachhaltigkeit
In einer Welt immer schnellerer Veränderungen, die einhergehen mit stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich Effektivität und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem wesentlichen Faktor für den Erfolg. Ressourcenbegrenzung, Klimawandel sowie Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen des Wirtschaftslebens. Wieviel Nachhaltigkeit muss sein, um weiterhin an der Spitze zu liegen oder dorthin zu kommen? Was nützen mir dabei die Managementsysteme, die meine Organisation unterhält? Umweltmanagement zum Schutz der Umwelt, Energiemanagement zum Schutz des Klimas, Arbeits- und Gesundheitsmanagement zum Schutz der Mitarbeiter, für die Kunden auch noch ein Qualitätsmanagement und ggf. weitere Managementsysteme? Viele Unternehmenslenker und Führungskräfte haben das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
In einer Welt immer schnellerer Veränderungen, die einhergehen mit stetig wachsenden Anforderungen hinsichtlich Effektivität und Effizienz von Produkten, Dienstleistungen und Prozessen wird Nachhaltigkeit zunehmend zu einem wesentlichen Faktor für den Erfolg. Ressourcenbegrenzung, Klimawandel sowie Digitalisierung verändern die Rahmenbedingungen des Wirtschaftslebens. Wieviel Nachhaltigkeit muss sein, um weiterhin an der Spitze zu liegen oder dorthin zu kommen? Was nützen mir dabei die Managementsysteme, die meine Organisation unterhält? Umweltmanagement zum Schutz der Umwelt, Energiemanagement zum Schutz des Klimas, Arbeits- und Gesundheitsmanagement zum Schutz der Mitarbeiter, für die Kunden auch noch ein Qualitätsmanagement und ggf. weitere Managementsysteme? Viele Unternehmenslenker und Führungskräfte haben das Gefühl, den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr zu sehen.
Orientierungshilfe
Um aus diesem Wald wieder herauszufinden, sind ein paar Fragen existenziell, deren Beantwortung ein Koordinatensystem ergibt, an dem man sich wie an Längen- und Breitengrad orientieren kann:
Um aus diesem Wald wieder herauszufinden, sind ein paar Fragen existenziell, deren Beantwortung ein Koordinatensystem ergibt, an dem man sich wie an Längen- und Breitengrad orientieren kann:
| • | Was versteht man unter Nachhaltigkeit im globalen, regionalen und lokalen Maßstab? |
| • | Wie ordnen sich Managementsysteme mit ihren definierten Forderungen in den Kontext der Nachhaltigkeit ein? |
| • | Gibt es Vorgaben und Methoden, Nachhaltigkeit messbar und damit greifbar zu machen? |
Aufbau und Vorgehen
In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen im ersten Teil die sachbezogenen Zusammenhänge zwischen Managementsystemen und dem Nachhaltigkeitsbegriff verdeutlichen. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen die ISO 9004 „Qualität einer Organisation – Anleitung zum nachhaltigen Erfolg” vorstellen, die als Werkzeug zur Umsetzung der Qualitätsnorm ISO 9001 entstanden ist. Die Grundsätze der in der 9004 geschaffenen Selbstbewertung machen es möglich, den Standort einer Organisation auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg über eine Bewertung nach dem Reifegradmodell zu bestimmen. Die Methodik der ISO 9004 lässt sich, unter Berücksichtigung der spezifischen Orientierung anderer auf ISO basierender Managementsysteme, auf diese oder ein integriertes Managementsystem übertragen.
In diesem Leitfaden möchten wir Ihnen im ersten Teil die sachbezogenen Zusammenhänge zwischen Managementsystemen und dem Nachhaltigkeitsbegriff verdeutlichen. Im zweiten Teil möchten wir Ihnen die ISO 9004 „Qualität einer Organisation – Anleitung zum nachhaltigen Erfolg” vorstellen, die als Werkzeug zur Umsetzung der Qualitätsnorm ISO 9001 entstanden ist. Die Grundsätze der in der 9004 geschaffenen Selbstbewertung machen es möglich, den Standort einer Organisation auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg über eine Bewertung nach dem Reifegradmodell zu bestimmen. Die Methodik der ISO 9004 lässt sich, unter Berücksichtigung der spezifischen Orientierung anderer auf ISO basierender Managementsysteme, auf diese oder ein integriertes Managementsystem übertragen.
Auch die Frage, ob diese Selbstbewertung ein zusätzlicher Aufwand ist oder ob man sie mit Instrumenten der Prüfung wie z. B. Internen Audits verbinden kann, die in Managementsystemen schon vorhanden sind, möchten wir in diesem Beitrag beantworten.
Als Arbeitshilfe finden Sie ein umfangreiches 60-seitiges Word-Dokument mit Selbstbewertungstabellen (basierend auf der ISO 9004) beigefügt, die eine integrierte Prüfung eines IMS nach den Regelwerken ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 ermöglichen. Mit dem Ergebnis erhält die Organisation eine Stärken-Schwächen-Analyse hinsichtlich wesentlicher Erfolgsfaktoren und eine Standortpositionierung auf dem Weg zum nachhaltigen Erfolg.[ 06304_a.docx]
06304_a.docx]
 06304_a.docx]
06304_a.docx]1.2 Kontext nachhaltiger Unternehmensführung
Nachhaltigkeit
Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit an vielen Stellen auch als Modewort für vieles unspezifisch verwendet – meist nicht in dem Kontext, in dem er im Jahre 1713 durch den Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde. Er bezog sich auf eine Forstwirtschaft, in der dem Wald nicht mehr entnommen werden sollte, als natürlich durch neues Wachstum an Holz entstehen konnte. An diesem Beispiel aus der Forstwirtschaft wird deutlich, wie eng Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden sind.
Der Begriff Nachhaltigkeit wird in der heutigen Zeit an vielen Stellen auch als Modewort für vieles unspezifisch verwendet – meist nicht in dem Kontext, in dem er im Jahre 1713 durch den Berghauptmann Hans Carl von Carlowitz geprägt wurde. Er bezog sich auf eine Forstwirtschaft, in der dem Wald nicht mehr entnommen werden sollte, als natürlich durch neues Wachstum an Holz entstehen konnte. An diesem Beispiel aus der Forstwirtschaft wird deutlich, wie eng Ökologie und Ökonomie miteinander verbunden sind.
Ökonomie braucht Ökologie
Es brauchte mehr als zweieinhalb Jahrhunderte, bis der Begriff Nachhaltigkeit wieder ins kollektive Bewusstsein der Menschen rückte. Auch wenn sich die moderne Diskussion über die Nachhaltigkeit so gut wie nie auf die ursprüngliche Herkunft des Begriffs bezieht, bleibt stets der Aspekt präsent und gültig, der von Anbeginn in ihm liegt: Die Natur als ökologische Basis bildet die ökonomische Grundlage menschlichen Wirtschaftens.
Es brauchte mehr als zweieinhalb Jahrhunderte, bis der Begriff Nachhaltigkeit wieder ins kollektive Bewusstsein der Menschen rückte. Auch wenn sich die moderne Diskussion über die Nachhaltigkeit so gut wie nie auf die ursprüngliche Herkunft des Begriffs bezieht, bleibt stets der Aspekt präsent und gültig, der von Anbeginn in ihm liegt: Die Natur als ökologische Basis bildet die ökonomische Grundlage menschlichen Wirtschaftens.
Corporate Social Responsibility
Mit der Industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann für den Menschen eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, ihrer Arbeitsbedingungen und Lebensumstände, die sich im 19. Jahrhundert weiterhin stark veränderten. Damit rückten der Mensch und sein Kontext in der Arbeitswelt und der Gesellschaft in den Fokus der Nachhaltigkeit. Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility (CSR)” gewannen für die Unternehmen soziale Fragestellungen in der Gesellschaft an Bedeutung. Die Anforderungen der Industriegesellschaft stellten eine neue, untrennbare Verbindung zwischen Menschen, Gesellschaft und Ökonomie her.
Mit der Industriellen Revolution in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts begann für den Menschen eine tiefgreifende und dauerhafte Umgestaltung ihrer wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse, ihrer Arbeitsbedingungen und Lebensumstände, die sich im 19. Jahrhundert weiterhin stark veränderten. Damit rückten der Mensch und sein Kontext in der Arbeitswelt und der Gesellschaft in den Fokus der Nachhaltigkeit. Unter dem Begriff „Corporate Social Responsibility (CSR)” gewannen für die Unternehmen soziale Fragestellungen in der Gesellschaft an Bedeutung. Die Anforderungen der Industriegesellschaft stellten eine neue, untrennbare Verbindung zwischen Menschen, Gesellschaft und Ökonomie her.
Heute beschreibt der Duden den Begriff Nachhaltigkeit im Sinne von Carlowitz als „Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, regenerieren oder künftig wieder bereitgestellt werden kann”. Mit dieser Definition werden allerdings viele relevante Aspekte des heutigen universellen Nachhaltigkeitsbegriffs nicht abgedeckt.
Dimensionen der Nachhaltigkeit
Die Definition der Europäischen Kommission von Anfang der 1990er-Jahre erweitert die sozialen Belange von CSR um die ökonomische Dimension. Fügt man diesen beiden Aspekten die ökologischen Belange hinzu, erhält man die heute gebräuchlichen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Bedeutung des Begriffs wird in erster Linie von Politik und Wissenschaft als globaler Ansatz gesehen, der die gesamte Welt und die gesamte Menschheit umfasst (z. B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Hunger und Armut). Die drei Säulen (Dimensionen) der Nachhaltigkeit sind in Abbildung 1 dargestellt.
Drei-Säulen-ModellDie Definition der Europäischen Kommission von Anfang der 1990er-Jahre erweitert die sozialen Belange von CSR um die ökonomische Dimension. Fügt man diesen beiden Aspekten die ökologischen Belange hinzu, erhält man die heute gebräuchlichen drei Dimensionen der Nachhaltigkeit. Die Bedeutung des Begriffs wird in erster Linie von Politik und Wissenschaft als globaler Ansatz gesehen, der die gesamte Welt und die gesamte Menschheit umfasst (z. B. Klimawandel, Bevölkerungswachstum, Hunger und Armut). Die drei Säulen (Dimensionen) der Nachhaltigkeit sind in Abbildung 1 dargestellt.
Abb. 1: Dimensionen der Nachhaltigkeit
Ökonomie – Ökologie – Soziales
Das Drei-Säulen-Modell bringt zum Ausdruck, dass sowohl die Wirtschaft (Ökonomie) als auch die Umwelt (Ökologie) und die Gesellschaft (Soziales) eine nachhaltige Entwicklung zu stützen vermögen, das nur ein Gleichgewicht zwischen den Säulen eine ausbalancierte Nachhaltigkeit, sprich Gebäudestabilität, ermöglicht. Jede einzelne Säule besteht aus Bausteinen, die die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen in ihrem Detail ausmachen. Die im Beispiel aufgeführten Bausteine erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein. Da Wirtschaft, Gesellschaft und auch Umwelt einem permanenten Wandel global wie regional unterliegen, sind Ergänzungen und Veränderungen jederzeit möglich.
Das Drei-Säulen-Modell bringt zum Ausdruck, dass sowohl die Wirtschaft (Ökonomie) als auch die Umwelt (Ökologie) und die Gesellschaft (Soziales) eine nachhaltige Entwicklung zu stützen vermögen, das nur ein Gleichgewicht zwischen den Säulen eine ausbalancierte Nachhaltigkeit, sprich Gebäudestabilität, ermöglicht. Jede einzelne Säule besteht aus Bausteinen, die die wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und ökologischen Dimensionen in ihrem Detail ausmachen. Die im Beispiel aufgeführten Bausteine erheben nicht den Anspruch vollständig zu sein. Da Wirtschaft, Gesellschaft und auch Umwelt einem permanenten Wandel global wie regional unterliegen, sind Ergänzungen und Veränderungen jederzeit möglich.
Wechselwirkung der Dimensionen
Was aus dem Drei-Säulen-Modell nicht direkt hervorgeht, ist der Umstand, dass es Schnittmengen zwischen den drei Dimensionen gibt. Dies soll Abbildung 2 verdeutlichen. Die Wechselwirkung zwischen den Dimensionen erzeugt Zielkonflikte in den Berührungszonen. Sie werden von Menschen gemacht und sind daher von ihnen auch beeinflussbar.
Abb. 2: Wechselwirkungen der Dimensionen
Was aus dem Drei-Säulen-Modell nicht direkt hervorgeht, ist der Umstand, dass es Schnittmengen zwischen den drei Dimensionen gibt. Dies soll Abbildung 2 verdeutlichen. Die Wechselwirkung zwischen den Dimensionen erzeugt Zielkonflikte in den Berührungszonen. Sie werden von Menschen gemacht und sind daher von ihnen auch beeinflussbar.
Umwelt versus Gesellschaft
Eine wachsende Erdbevölkerung erzeugt zwangsläufig einen erhöhten Ressourcenbedarf, der die Umwelt in Form von Bodenbelastung, Wasserverschmutzung, Luftverunreinigung usw. belastet. Eine faire Nutzung der vorhandenen Ressourcen, die die Möglichkeiten der Natur nicht überbeansprucht, ist daher zu gewährleisten.
Eine wachsende Erdbevölkerung erzeugt zwangsläufig einen erhöhten Ressourcenbedarf, der die Umwelt in Form von Bodenbelastung, Wasserverschmutzung, Luftverunreinigung usw. belastet. Eine faire Nutzung der vorhandenen Ressourcen, die die Möglichkeiten der Natur nicht überbeansprucht, ist daher zu gewährleisten.
Umwelt versus Wirtschaft
Unternehmen wollen Rentabilität und ggf. Wachstum zu noch mehr Rentabilität. Dies ist gemäß den Grundsätzen der Wirtschaft so lange plausibel, wie es nicht einhergeht mit dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, etwa überfischten Meeren, abgeholzten Wäldern oder der Vergiftung von Boden, Luft und Wasser. Eine Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen durch eine ungelenkte Wirtschaft ist daher unbedingt zu vermeiden.
Unternehmen wollen Rentabilität und ggf. Wachstum zu noch mehr Rentabilität. Dies ist gemäß den Grundsätzen der Wirtschaft so lange plausibel, wie es nicht einhergeht mit dem Raubbau an natürlichen Ressourcen, etwa überfischten Meeren, abgeholzten Wäldern oder der Vergiftung von Boden, Luft und Wasser. Eine Zerstörung der Lebensgrundlagen der Menschen durch eine ungelenkte Wirtschaft ist daher unbedingt zu vermeiden.
Wirtschaft versus Gesellschaft
Unternehmen wollen rentabel produzieren; dazu gehört es, die Kostenseite stetig zu optimieren. Dies sollte aber lebenswerte gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Menschen, Mitarbeiter und deren Familien einschließen. So sollten Lohndumping, gefährliche Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Korruption usw. nicht zu den Optimierungsinstrumenten einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören.
Unternehmen wollen rentabel produzieren; dazu gehört es, die Kostenseite stetig zu optimieren. Dies sollte aber lebenswerte gesellschaftliche Rahmenbedingungen für Menschen, Mitarbeiter und deren Familien einschließen. So sollten Lohndumping, gefährliche Arbeitsbedingungen, Kinderarbeit, Korruption usw. nicht zu den Optimierungsinstrumenten einer nachhaltigen Unternehmensführung gehören.
Global Compact Pakt
Das Drei-Säulen-Modell gibt in seiner einfachen Struktur einen guten Überblick über das Wesen der Nachhaltigkeit. Kritiker bemängeln jedoch die mangelnde Operationalisierbarkeit, die notwendig ist, um praktische Konsequenzen daraus abzuleiten. Im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien sind daher Kriterien/Prinzipien von verschiedensten Institutionen erarbeitet worden. Zu nennen wäre zum einen die UNO mit dem Global-Compact-Pakt, dem Unternehmen freiwillig beitreten können [7]. Der Nachhaltigkeitsansatz umfasst zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruption.
Das Drei-Säulen-Modell gibt in seiner einfachen Struktur einen guten Überblick über das Wesen der Nachhaltigkeit. Kritiker bemängeln jedoch die mangelnde Operationalisierbarkeit, die notwendig ist, um praktische Konsequenzen daraus abzuleiten. Im Rahmen von Nachhaltigkeitsstrategien sind daher Kriterien/Prinzipien von verschiedensten Institutionen erarbeitet worden. Zu nennen wäre zum einen die UNO mit dem Global-Compact-Pakt, dem Unternehmen freiwillig beitreten können [7]. Der Nachhaltigkeitsansatz umfasst zehn Prinzipien aus den Bereichen Menschenrechte, Arbeitsstandards, Umweltschutz und Korruption.
Deutscher Nachhaltigkeitskodex
Eine andere Variante bietet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex aus dem Jahr 2011 [8]. Er definiert 20 Kriterien, die in vier Cluster gegliedert sind (Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft). Beide Regelwerke haben das Ziel, dem Nachhaltigkeitsprinzip eine Struktur zu geben, die vergleichbare Berichtsformen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Ansätze, das Thema Nachhaltigkeit für Branchen und Unternehmen mess- und bewertbar zu machen.
Eine andere Variante bietet der Deutsche Nachhaltigkeitskodex aus dem Jahr 2011 [8]. Er definiert 20 Kriterien, die in vier Cluster gegliedert sind (Strategie, Prozessmanagement, Umwelt und Gesellschaft). Beide Regelwerke haben das Ziel, dem Nachhaltigkeitsprinzip eine Struktur zu geben, die vergleichbare Berichtsformen ermöglicht. Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Ansätze, das Thema Nachhaltigkeit für Branchen und Unternehmen mess- und bewertbar zu machen.
Gerade für international agierende Unternehmen sind nicht mehr ausschließlich die Finanzzahlen in den Bilanzen das einzige Kriterium für Anleger, Kunden oder sonstige Interessengruppen, anhand deren sie eine Bewertung der Zukunftsfähigkeit eines Unternehmens vornehmen. Die nichtfinanziellen Leistungen zu den Aspekten Ökonomie, Ökologie und Sozialem werden zunehmend in die Bewertung miteinbezogen. Daher wird CSR zukünftig ein Kernstück des Wachstums von Unternehmen sein und durch einheitliche Berichtsstandards werden die Leistungen unterschiedlicher Unternehmen vergleichbar.
Berichtspflicht größerer börsennotierter Unternehmen
Mit der Richtlinie 2014/95/EU [9] (CSD-Richtlinie) hat die EU am 22.10.2014 eine rechtliche Vorgabe gemacht, dass größere börsennotierte Unternehmen ihre Daten zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung der Korruption in regelmäßigen Abständen erheben und öffentlich bereitstellen müssen. In Deutschland sind von dieser Berichtspflicht ca. 540 Unternehmen betroffen. Die EU-Richtlinie wurde im April 2017 mit dem CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in deutsches Recht überführt. Inhaltlich wurden keine substanziellen Änderungen vorgenommen. Bereits im Dezember 2022 wurde die bestehende CSD-Richtlinie von der EU mit der CSDR-Richtline (Richtlinie 2022/2464/EU [10]) verschärft. Die CSDR-Richtlinie soll Lücken in den geltenden Vorschriften über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen schließen. Dabei wird eine detailliertere Berichtspflicht eingeführt und es wird sichergestellt, dass große Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsfragen wie Umweltrechten, sozialen Rechten, Menschenrechten und Governance-Faktoren in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts des Unternehmens zu veröffentlichen. Damit soll die Vergleichbarkeit der Berichterstattung verbessert werden. Dazu gibt es den European Sustainability Reporting Standard (ESRS) [11], der für die Unternehmen verbindlich ist. Auch die Anzahl an Unternehmen, für die diese Berichtspflicht gilt, wird deutlich ausgeweitet. Nach Schätzungen der EU werden allein in Deutschland davon ca. 15.000 Unternehmen betroffen sein. Die Bundesregierung plant, die neue Richtlinie in einer Novellierung des CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes bis Juli 2024 in deutsches Recht umzusetzen.
Mit der Richtlinie 2014/95/EU [9] (CSD-Richtlinie) hat die EU am 22.10.2014 eine rechtliche Vorgabe gemacht, dass größere börsennotierte Unternehmen ihre Daten zu Umwelt-, Sozial- und Arbeitnehmerbelangen, zur Achtung der Menschenrechte und zur Bekämpfung der Korruption in regelmäßigen Abständen erheben und öffentlich bereitstellen müssen. In Deutschland sind von dieser Berichtspflicht ca. 540 Unternehmen betroffen. Die EU-Richtlinie wurde im April 2017 mit dem CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetz in deutsches Recht überführt. Inhaltlich wurden keine substanziellen Änderungen vorgenommen. Bereits im Dezember 2022 wurde die bestehende CSD-Richtlinie von der EU mit der CSDR-Richtline (Richtlinie 2022/2464/EU [10]) verschärft. Die CSDR-Richtlinie soll Lücken in den geltenden Vorschriften über die Offenlegung nichtfinanzieller Informationen schließen. Dabei wird eine detailliertere Berichtspflicht eingeführt und es wird sichergestellt, dass große Unternehmen verpflichtet sind, Informationen zu Nachhaltigkeitsfragen wie Umweltrechten, sozialen Rechten, Menschenrechten und Governance-Faktoren in einem gesonderten Abschnitt des Lageberichts des Unternehmens zu veröffentlichen. Damit soll die Vergleichbarkeit der Berichterstattung verbessert werden. Dazu gibt es den European Sustainability Reporting Standard (ESRS) [11], der für die Unternehmen verbindlich ist. Auch die Anzahl an Unternehmen, für die diese Berichtspflicht gilt, wird deutlich ausgeweitet. Nach Schätzungen der EU werden allein in Deutschland davon ca. 15.000 Unternehmen betroffen sein. Die Bundesregierung plant, die neue Richtlinie in einer Novellierung des CSD-Richtlinien-Umsetzungsgesetzes bis Juli 2024 in deutsches Recht umzusetzen.
Nachhaltigkeitskodex
Kleinere Unternehmen können freiwillig an dem Berichtssystem teilnehmen. Hilfestellung dazu bildet der Leitfaden „Zum deutschen Nachhaltigkeitskodex – Orientierungshilfe für mittelständische Unternehmen” [12], den der Rat für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung herausgegeben hat. Eine Offenlegung der Ergebnisse ist nicht gefordert, aber es gibt gute Gründe der Imagepflege, getreu dem alten Motto „Tu Gutes und sprich darüber”, die Ergebnisse ganz oder teilweise zu veröffentlichen.
Kleinere Unternehmen können freiwillig an dem Berichtssystem teilnehmen. Hilfestellung dazu bildet der Leitfaden „Zum deutschen Nachhaltigkeitskodex – Orientierungshilfe für mittelständische Unternehmen” [12], den der Rat für nachhaltige Entwicklung in Kooperation mit der Bertelsmann Stiftung herausgegeben hat. Eine Offenlegung der Ergebnisse ist nicht gefordert, aber es gibt gute Gründe der Imagepflege, getreu dem alten Motto „Tu Gutes und sprich darüber”, die Ergebnisse ganz oder teilweise zu veröffentlichen.
1.3 Managementsysteme und Nachhaltigkeit
Schwache vs. starke Nachhaltigkeit
Neben der unklaren Zuordnung, was alles unter den Begriff Nachhaltigkeit genau zu subsumieren ist, lässt sich aus dem Drei-Säulen-Modell auch die Wertigkeit der drei Säulen und seiner Einzelkriterien nicht spezifizieren. Die Frage, was ist wichtiger: Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft oder ist alles gleichwertig, muss im Einzelnen geklärt werden. In der Wissenschaft wird der Ansatz von schwacher oder starker Nachhaltigkeit verfolgt. Schwache Nachhaltigkeit wird geprägt von der Vorstellung, dass sich ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen gegeneinander aufwiegen lassen. So wäre es im Rahmen schwacher Nachhaltigkeit akzeptabel, dass Naturressourcen und damit Naturkapital erschöpft würden, wenn dem eine angemessene Menge an geschaffenem Humankapital oder Sachkapital gegenüberstände. Ökonomie und Ökologie wären dann als gleichrangig anzusehen.
Neben der unklaren Zuordnung, was alles unter den Begriff Nachhaltigkeit genau zu subsumieren ist, lässt sich aus dem Drei-Säulen-Modell auch die Wertigkeit der drei Säulen und seiner Einzelkriterien nicht spezifizieren. Die Frage, was ist wichtiger: Wirtschaft, Umwelt oder Gesellschaft oder ist alles gleichwertig, muss im Einzelnen geklärt werden. In der Wissenschaft wird der Ansatz von schwacher oder starker Nachhaltigkeit verfolgt. Schwache Nachhaltigkeit wird geprägt von der Vorstellung, dass sich ökologische, ökonomische und soziale Ressourcen gegeneinander aufwiegen lassen. So wäre es im Rahmen schwacher Nachhaltigkeit akzeptabel, dass Naturressourcen und damit Naturkapital erschöpft würden, wenn dem eine angemessene Menge an geschaffenem Humankapital oder Sachkapital gegenüberstände. Ökonomie und Ökologie wären dann als gleichrangig anzusehen.
Starke Nachhaltigkeit würde bedeuten, dass Naturkapital nur sehr beschränkt oder gar nicht ersetzbar wäre durch Human- oder Sachkapital. Die Ökologie wäre die Grundlage, und nur im Rahmen von zulässigen Parametern (Leitplanken) wäre eine Entwicklung von Human- und/oder Sachkapital möglich.
Die wissenschaftliche Nachhaltigkeitsdebatte ist noch nicht beendet. Welche Aspekte dabei mit einzubeziehen sind und welche nicht, wird auf absehbare Zeit auch nicht geklärt werden. Fakt ist, dass keine der drei Säulen für sich allein steht, sondern dass integrative Ansätze die Wechselwirkungen beschreiben müssen. Alle Bemühungen um Nachhaltigkeit müssen
| • | die Sicherung der menschlichen Existenz, |
| • | die Erhaltung des gesellschaftlichen Produktivpotenzials und |
| • | die Bewahrung der Entwicklungs- und Handlungsmöglichkeiten für die Zukunft |
in ausgeglichener Balance zum Ergebnis haben.
Globale Dimension
Der Ansatz einer globalen oder EU-weiten Nachhaltigkeit wird den Belangen von Unternehmen und Organisationen nicht gerecht und lässt sich operativ mangels signifikanter Steuerungsgrößen auch nicht umsetzen. So ist zum Beispiel wirksamer Klimaschutz eine staatliche oder sogar überstaatliche Aufgabe, zu der Unternehmen ihren Beitrag leisten können, wogegen ihr Einflussvermögen angesichts globaler Dimensionen eher begrenzt ist.
Der Ansatz einer globalen oder EU-weiten Nachhaltigkeit wird den Belangen von Unternehmen und Organisationen nicht gerecht und lässt sich operativ mangels signifikanter Steuerungsgrößen auch nicht umsetzen. So ist zum Beispiel wirksamer Klimaschutz eine staatliche oder sogar überstaatliche Aufgabe, zu der Unternehmen ihren Beitrag leisten können, wogegen ihr Einflussvermögen angesichts globaler Dimensionen eher begrenzt ist.
Einflussgrößen
Das Ausmaß der Einflussmöglichkeiten von Unternehmen auf die Nachhaltigkeit ist aber keine konstante Größe, sondern abhängig von
Das Ausmaß der Einflussmöglichkeiten von Unternehmen auf die Nachhaltigkeit ist aber keine konstante Größe, sondern abhängig von
| • | der Größe des Unternehmens (KMU oder Konzern), |
| • | der globalen oder lokalen Präsenz (Handwerksbetrieb, Global Player) und |
| • | der Branche und den damit einhergehenden Auswirkungen (z. B. Automobilindustrie, Chemieindustrie oder Banken). |
Interessierte Parteien
Welche Nachhaltigkeitsthemen in welchem Maß für ein Unternehmen oder eine Organisation eine Bedeutung haben, hängt entscheidend von seinem Kontext und den Interessierten Parteien (Stakeholder) und deren Erwartungen an das Unternehmen oder die Organisation ab. An dieser Stelle haben Nachhaltigkeit und Managementsysteme (z. B. ISO 9001, 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts und 4.2 Erfordernisse und Verstehen der Erwartungen interessierter Parteien/Stakeholder) hinsichtlich zu erfüllender Anforderungen eine gemeinsame Ausgangsbasis.
Welche Nachhaltigkeitsthemen in welchem Maß für ein Unternehmen oder eine Organisation eine Bedeutung haben, hängt entscheidend von seinem Kontext und den Interessierten Parteien (Stakeholder) und deren Erwartungen an das Unternehmen oder die Organisation ab. An dieser Stelle haben Nachhaltigkeit und Managementsysteme (z. B. ISO 9001, 4.1 Verstehen der Organisation und ihres Kontexts und 4.2 Erfordernisse und Verstehen der Erwartungen interessierter Parteien/Stakeholder) hinsichtlich zu erfüllender Anforderungen eine gemeinsame Ausgangsbasis.
Kontext- und Stakeholderanalyse
Die Aufgabe besteht darin, für das eigene Unternehmen in einer Transformation aus den übergeordneten Themen der drei Nachhaltigkeitssäulen sowie der Kontext- und Stakeholder-Analyse der vorhandenen Managementsysteme die für das Unternehmen relevanten Themen zu identifizieren und ggf. einzelne wichtige Themen auf die Bedürfnisse des Unternehmens (z. B. hinsichtlich Nutzen oder Beeinflussbarkeit) herunterzubrechen.
Die Aufgabe besteht darin, für das eigene Unternehmen in einer Transformation aus den übergeordneten Themen der drei Nachhaltigkeitssäulen sowie der Kontext- und Stakeholder-Analyse der vorhandenen Managementsysteme die für das Unternehmen relevanten Themen zu identifizieren und ggf. einzelne wichtige Themen auf die Bedürfnisse des Unternehmens (z. B. hinsichtlich Nutzen oder Beeinflussbarkeit) herunterzubrechen.
Art des Kontaktes
In Bezug auf die Bedeutung von Kontext und Stakeholdern ist für das Unternehmen auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse zu berücksichtigen, ob ein unmittelbarer (häufiger) Kontakt im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit vorliegt (z. B. Lieferanten, direkte Kunden, Behörden) oder nur eine mittelbare (gelegentliche) Beziehung besteht (z. B. Politik, Medien, Marktteilnehmer). Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine Nachhaltigkeitstabelle für ein Unternehmen.
In Bezug auf die Bedeutung von Kontext und Stakeholdern ist für das Unternehmen auch im Rahmen der Nachhaltigkeitsanalyse zu berücksichtigen, ob ein unmittelbarer (häufiger) Kontakt im Rahmen der wirtschaftlichen Tätigkeit vorliegt (z. B. Lieferanten, direkte Kunden, Behörden) oder nur eine mittelbare (gelegentliche) Beziehung besteht (z. B. Politik, Medien, Marktteilnehmer). Die Tabelle 1 zeigt beispielhaft eine Nachhaltigkeitstabelle für ein Unternehmen.
Tabelle 1: Nachhaltigkeitsthemen eines Unternehmens
Wirtschaft | Gesellschaft | Umwelt |
Erwirtschaften von Umsätzen und Gewinn | Gesetze und rechtliche Regelungen achten | Einsatz von gefährlichen Stoffen vermeiden |
Schaffen und Erhalten von Arbeitsplätzen | Menschenrechte achten und Diskriminierung vermeiden | Ressourcen und Energie effizient nutzen |
Innovation fördern und Investitionsbereitschaft | gute und sichere Arbeitsbedingungen | Erneuerbare Materialien und Energiequellen verwenden |
angemessene Steuerentrichtung | gute Beziehungen zu Anwohnern und anderen Stakeholdern | Bodenverbrauch minimieren und Artenvielfalt erhalten |
Beiträge zur Stärkung der lokalen Wirtschaft | Produkt- und Dienstleistungssicherheit | schädliche Abfälle und Abwässer vermeiden |
Korruption bekämpfen | respektvoll mit Partnern, Lieferanten und Kunden umgehen | effiziente Recyclingstrategien fördern |
Kompetenzen entwickeln und Qualifikation fördern | Arbeitnehmerinteressen wahren | schädliche Emissionen und Klimaschutz vermeiden |
Qualität von Produkten und Prozessen | demografische Entwicklung berücksichtigen | Energieeffiziente Produktionsmittel einsetzen |
keine Kinder- und Zwangsarbeit | Bildung und Ausbildung fördern | Produktlebenszyklus berücksichtigen |
MS konkretisieren Forderungen der Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit steht für eine ganzheitliche Strategie eines Unternehmens. Ein Managementsystem hingegen strukturiert ein bestimmtes Handlungsfeld, d. h., es konzentriert sich auf einen oder mehrere Aspekte der nachhaltigen Unternehmensführung, z. B. mit der ISO 9001 auf Qualität oder mit der ISO 14001 auf Umwelt. Das bedeutet, Managementsysteme können ausführender Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie sein. Sie konkretisieren dort Forderungen, wo die Nachhaltigkeitsthemen unkonkret, nicht operational bleiben.
Nachhaltigkeit steht für eine ganzheitliche Strategie eines Unternehmens. Ein Managementsystem hingegen strukturiert ein bestimmtes Handlungsfeld, d. h., es konzentriert sich auf einen oder mehrere Aspekte der nachhaltigen Unternehmensführung, z. B. mit der ISO 9001 auf Qualität oder mit der ISO 14001 auf Umwelt. Das bedeutet, Managementsysteme können ausführender Teil einer Nachhaltigkeitsstrategie sein. Sie konkretisieren dort Forderungen, wo die Nachhaltigkeitsthemen unkonkret, nicht operational bleiben.
Schwerpunkte im Nachhaltigkeitsansatz sind Themen, die die Ökonomie, die Ökologie sowie die Gesellschaft und das Soziale abbilden. Wenn man die thematisch zugehörigen Managementsysteme der ISO betrachtet, lässt sich eine Zuordnung zu den drei Dimensionen der Nachhaltigkeit bilden, wie in Abbildung 3 dargestellt.
Abb. 3: Dimensionen der Nachhaltigkeit und Bezug zu ISO-Normen
EMAS III
Zur Dimension Umwelt/Klima lässt sich auch noch die EMAS III (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) der EU zählen.
Zur Dimension Umwelt/Klima lässt sich auch noch die EMAS III (EMAS = Eco-Management and Audit Scheme) der EU zählen.
IMS
Unternehmen, die eine Mehrzahl von Managementsystemen implementiert und integriert haben – sog. „Integrierte Managementsysteme (IMS)”, können diese Managementsysteme als Werkzeuge zur operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen verwenden, auch wenn die derzeit auf dem Markt befindlichen ISO-Normen nicht alle Themen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie benötigt, abdecken können. Betrachtet man ein IMS, wie es bei einer größeren Zahl von Unternehmen und Organisationen bereits gelebt wird, mit den Normen ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 50001, ergibt sich folgende Einschätzung:
Unternehmen, die eine Mehrzahl von Managementsystemen implementiert und integriert haben – sog. „Integrierte Managementsysteme (IMS)”, können diese Managementsysteme als Werkzeuge zur operativen Umsetzung von Nachhaltigkeitsthemen verwenden, auch wenn die derzeit auf dem Markt befindlichen ISO-Normen nicht alle Themen, die eine Nachhaltigkeitsstrategie benötigt, abdecken können. Betrachtet man ein IMS, wie es bei einer größeren Zahl von Unternehmen und Organisationen bereits gelebt wird, mit den Normen ISO 9001/ISO 14001/ISO 45001/ISO 50001, ergibt sich folgende Einschätzung:
| Umwelt (Ökologie) | |
| • | Die stärkste Überdeckung der gängigen Nachhaltigkeitsanforderungen im Bereich der Ökologie mit einer Erfüllung durch ISO-Normen haben Unternehmen, die ein Umwelt- und Energiemanagementsystem nach ISO 14001 und ISO 50001 (oder Ersatzweise die EMAS) unterhalten. Für die meisten Unternehmen bleibt über die Erfüllung der Normenanforderungen hinaus nicht mehr viel zur Nachhaltigkeit zu tun, da ca. 75 % der Nachhaltigkeitsthemen, die eine Organisation beeinflussen kann, normativ abgedeckt werden. |
| Wirtschaft (Ökonomie) | |
| • | Die Anforderungen eines Qualitätsmanagementsystems beziehen sich nur auf einen Teil der Nachhaltigkeitsthemen zur Ökologie. Überwiegend abgedeckt sind durch die ISO 9001 die Themen sichere Prozesse sowie sichere Produkte/Dienstleistungen, Kompetenzförderung und Kundenorientierung. Mit diesen Themen sind aber weniger als 50 % der möglichen Themenfelder der Nachhaltigkeit berücksichtigt. Mit der ISO 37001 (Korruption) und der ISO/IEC 27001 (Informationssicherheit) kann der Beitrag zur Nachhaltigkeit auf über 50 % gesteigert werden. |
| Gesellschaft (Soziales) | |
| • | Den geringsten Abdeckungsgrad hinsichtlich der Nachhaltigkeitsdimension hat die ISO 45001 „Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit” (SGA-MS). Sie beschränkt ihren Wirkungsbereich im Wesentlichen auf die eigenen Arbeitnehmer und deren Schutz vor psychischer und physischer Gefährdung am Arbeitsplatz sowie den Schutz vor negativen Langzeitauswirkungen durch die Arbeit. Durch die ISO 45001 erfüllt ein Unternehmen vielleicht 25 % der möglichen Themen zur gesellschaftlichen Nachhaltigkeit. Themen wie z. B. Kinderarbeit oder Menschenrechte sind nicht Regelungsbestandteil der ISO 45001. Auch die Arbeitsbedingungen in weltweiten Lieferketten stehen nicht im Fokus. Gleiches gilt für soziale und gesellschaftliche Themen außerhalb der Arbeitswelt. An dieser Stelle bietet sich mit der ISO 26000 ein Leitfaden an, der Hilfestellung bietet bei der Umsetzung von gesellschaftlicher Verantwortung. Der Leitfaden ist kein Zertifizierungsstandard, enthält aber ausführliche Vorschläge zur Wahrnehmung gesellschaftlicher Verantwortung. In Verbindung mit der ISO 45001 lassen sich so auch auf diesem Gebiet bis zu 50 % Umsetzungsgrad für die Organisation erreichen. |
Einordnung der Unternehmen
Die Betrachtung von Nachhaltigkeitsthemen ist geboren aus einem globalen Ansatz mit dem Ziel, die Lebensgrundlagen der Menschheit in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren. Die weltweite Betrachtungsebene ist für die meisten Unternehmen mindestens eine Stufe (weltweit operierende Konzerne) wenn nicht sogar zwei Stufen (Mittelstand mit regionalem Schwerpunkt) zu hoch. Der Ansatz für Unternehmen wird sich in der Regel auf die Nachhaltigkeitsthemen beschränken, die das Unternehmen direkt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit beeinflussen kann und ggf. noch Themen, die dem Unternehmen wichtig sind und auf die indirekt über Kunden, Lieferanten, Verbände und andere interessierte Parteien Einfluss genommen werden kann.
Die Betrachtung von Nachhaltigkeitsthemen ist geboren aus einem globalen Ansatz mit dem Ziel, die Lebensgrundlagen der Menschheit in der Gegenwart und für die Zukunft zu bewahren. Die weltweite Betrachtungsebene ist für die meisten Unternehmen mindestens eine Stufe (weltweit operierende Konzerne) wenn nicht sogar zwei Stufen (Mittelstand mit regionalem Schwerpunkt) zu hoch. Der Ansatz für Unternehmen wird sich in der Regel auf die Nachhaltigkeitsthemen beschränken, die das Unternehmen direkt im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit beeinflussen kann und ggf. noch Themen, die dem Unternehmen wichtig sind und auf die indirekt über Kunden, Lieferanten, Verbände und andere interessierte Parteien Einfluss genommen werden kann.
Empfehlung
Für internationale Konzerne und Großunternehmen wäre eine Mitgliedschaft im United Nations Global Compact ein Ansatz, ihre Nachhaltigkeitsstrategie thematisch auszurichten. Für mittelständische Unternehmen bietet sich als einfacherer Standard der Deutsche Nachhaltigkeitskodex mit seinen 20 Nachhaltigkeitskriterien als Richtschnur an.
Für internationale Konzerne und Großunternehmen wäre eine Mitgliedschaft im United Nations Global Compact ein Ansatz, ihre Nachhaltigkeitsstrategie thematisch auszurichten. Für mittelständische Unternehmen bietet sich als einfacherer Standard der Deutsche Nachhaltigkeitskodex mit seinen 20 Nachhaltigkeitskriterien als Richtschnur an.
Nachhaltigkeitsthemen komplettieren
Nachhaltigkeitsstrategie und Managementsysteme gehören zusammen. Übergeordnet sind aber die Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Einzelthemen. Da, wo ein Nachhaltigkeitsthema durch ein Managementsystem untersetzt ist, hat das Unternehmen den Vorteil, dass über das Managementsystem vorgegeben ist, was alles zur Erfüllung geregelt sein muss. Wie es im Einzelnen geregelt wird, liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Gibt es kein Managementsystem zum Nachhaltigkeitsthema, muss das Unternehmen selbst festlegen, was zu diesem Thema alles geregelt werden soll, um dann das Wie zu bestimmen. An dieser Stelle kommen wieder Standards wie der Global Compact oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ins Spiel. Sie bieten einen Rahmen, in dem sich Unternehmen die für sie relevanten Themen und Vorgaben der Nachhaltigkeit heraussuchen können. Mittels interner Festlegungen (z. B. Prozesse) können sie diese als freiwillige Verpflichtung in das IMS aufnehmen.
Nachhaltigkeitsstrategie und Managementsysteme gehören zusammen. Übergeordnet sind aber die Nachhaltigkeitsstrategie und ihre Einzelthemen. Da, wo ein Nachhaltigkeitsthema durch ein Managementsystem untersetzt ist, hat das Unternehmen den Vorteil, dass über das Managementsystem vorgegeben ist, was alles zur Erfüllung geregelt sein muss. Wie es im Einzelnen geregelt wird, liegt in der Verantwortung des Unternehmens. Gibt es kein Managementsystem zum Nachhaltigkeitsthema, muss das Unternehmen selbst festlegen, was zu diesem Thema alles geregelt werden soll, um dann das Wie zu bestimmen. An dieser Stelle kommen wieder Standards wie der Global Compact oder der Deutsche Nachhaltigkeitskodex ins Spiel. Sie bieten einen Rahmen, in dem sich Unternehmen die für sie relevanten Themen und Vorgaben der Nachhaltigkeit heraussuchen können. Mittels interner Festlegungen (z. B. Prozesse) können sie diese als freiwillige Verpflichtung in das IMS aufnehmen.
Nachhaltigkeitsbericht
Ein weiterer Vorteil bei Managementsystemen ist, dass eine unabhängige Stelle (z. B. Zertifizierungsgesellschaft) bescheinigt, dass die Mindestanforderungen des Standards erfüllt sind. Im Fall der Nachhaltigkeit erfolgt der Nachweis der Umsetzung über einen vom Unternehmen regelmäßig erstellten (strukturierten) Nachhaltigkeitsbericht, der veröffentlicht werden muss. Die Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten ist häufig wegen fehlender gemeinsamer Standards problematisch. Auditberichte von Zertifizierungsgesellschaften sind wegen gemeinsamer Vorgaben durch die Akkreditierungsgesellschaften besser vergleichbar.
Ein weiterer Vorteil bei Managementsystemen ist, dass eine unabhängige Stelle (z. B. Zertifizierungsgesellschaft) bescheinigt, dass die Mindestanforderungen des Standards erfüllt sind. Im Fall der Nachhaltigkeit erfolgt der Nachweis der Umsetzung über einen vom Unternehmen regelmäßig erstellten (strukturierten) Nachhaltigkeitsbericht, der veröffentlicht werden muss. Die Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten ist häufig wegen fehlender gemeinsamer Standards problematisch. Auditberichte von Zertifizierungsgesellschaften sind wegen gemeinsamer Vorgaben durch die Akkreditierungsgesellschaften besser vergleichbar.
2.1 Grenzen und Chancen von Internen Audits
Erfüllung von Mindestanforderungen
Alle gängigen zertifizierfähigen auf ISO basierenden Managementsysteme, z. B. die ISO 9001, ISO 140001, ISO 45001 oder ISO 50001, fordern die Durchführung von internen Audits in regelmäßigen Abständen. Die internen Audits sollen zum einen die Konformität mit dem zugrundeliegenden Regelwerk (Norm) überprüfen und zum anderen mögliches Verbesserungspotenzial für das System und seine Prozesse identifizieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. In zertifizierten Managementsystemen wird die Normenkonformität durch das Zertifizierungsverfahren und seine Audits (Überwachung und Rezertifizierung) regelmäßig überprüft. Ergebnis ist die Erfüllung einer Mindestanforderung, die durch das Zertifizierungsverfahren definiert ist. Das Ergebnis wird nicht quantifiziert (z. B. nach Notensystem), sondern beschränkt sich auf Bestanden oder Nicht-Bestanden. In internen Audits sollte die Normenkonformität nach der Erstzertifizierung nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern nur noch als Generalprobe vor einem Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudit dienen. Dazu sollten ein Viertel bis maximal ein Drittel der Zeit eines internen Audits ausreichen.
Alle gängigen zertifizierfähigen auf ISO basierenden Managementsysteme, z. B. die ISO 9001, ISO 140001, ISO 45001 oder ISO 50001, fordern die Durchführung von internen Audits in regelmäßigen Abständen. Die internen Audits sollen zum einen die Konformität mit dem zugrundeliegenden Regelwerk (Norm) überprüfen und zum anderen mögliches Verbesserungspotenzial für das System und seine Prozesse identifizieren, um deren Wirksamkeit zu erhöhen. In zertifizierten Managementsystemen wird die Normenkonformität durch das Zertifizierungsverfahren und seine Audits (Überwachung und Rezertifizierung) regelmäßig überprüft. Ergebnis ist die Erfüllung einer Mindestanforderung, die durch das Zertifizierungsverfahren definiert ist. Das Ergebnis wird nicht quantifiziert (z. B. nach Notensystem), sondern beschränkt sich auf Bestanden oder Nicht-Bestanden. In internen Audits sollte die Normenkonformität nach der Erstzertifizierung nicht mehr im Mittelpunkt stehen, sondern nur noch als Generalprobe vor einem Überwachungs- oder Rezertifizierungsaudit dienen. Dazu sollten ein Viertel bis maximal ein Drittel der Zeit eines internen Audits ausreichen.
Fortlaufende Verbesserung
Schwerpunkt der internen Audits mit dem deutlich größeren Zeitanteil, sollte die fortlaufende Verbesserung sein. In Überwachungsaudits- und Rezertifizierungsaudits werden durch die externen Auditoren auch Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet, aber diese stehen nicht im Mittelpunkt ihrer Audits. Sie sind in der Regel Auditfeststellungen, die bei der Regelkonformitätsprüfung nebenbei anfallen. In internen Audits sollte der Auditschwerpunkt auf der systematischen Ermittlung von Potenzialen zur Verbesserung der Systemwirksamkeit und ihrer Prozesse der Prüfgegenstand der einzelnen Norm sein. Das wären z. B.
Schwerpunkt der internen Audits mit dem deutlich größeren Zeitanteil, sollte die fortlaufende Verbesserung sein. In Überwachungsaudits- und Rezertifizierungsaudits werden durch die externen Auditoren auch Vorschläge zur Verbesserung unterbreitet, aber diese stehen nicht im Mittelpunkt ihrer Audits. Sie sind in der Regel Auditfeststellungen, die bei der Regelkonformitätsprüfung nebenbei anfallen. In internen Audits sollte der Auditschwerpunkt auf der systematischen Ermittlung von Potenzialen zur Verbesserung der Systemwirksamkeit und ihrer Prozesse der Prüfgegenstand der einzelnen Norm sein. Das wären z. B.
| • | im Qualitätsmanagementsystem (QMS) die Produkt- und/oder Dienstleistungsqualität sowie die Kundenzufriedenheit, |
| • | im Umweltmanagement (UMS) der Umweltschutz sowie die Minimierung der Umweltauswirkungen der eigenen Tätigkeiten, |
| • | im Arbeitsschutzmanagement (SGU) der Arbeits- und Gesundheitsschutz von Mitarbeitern und betroffenen Parteien und |
| • | im Energiemanagement (EnMS) die Energieeffizienz in Produktion und Verwaltung sowie der Klimaschutz. |
Best Practice anstreben
Im Sinne möglichst bester Ergebnisse von Managementsystemen ist die Prüfung eines Mindeststandards in internen Audits nicht zielführend, sondern das Ergebnis sollte messbar sein, und das Auditergebnis sollte eine schrittweise Einstufung in der Bandbreite von „Anforderung nicht erfüllt” bis „Best Practice” ermöglichen.
Im Sinne möglichst bester Ergebnisse von Managementsystemen ist die Prüfung eines Mindeststandards in internen Audits nicht zielführend, sondern das Ergebnis sollte messbar sein, und das Auditergebnis sollte eine schrittweise Einstufung in der Bandbreite von „Anforderung nicht erfüllt” bis „Best Practice” ermöglichen.
Ziel: Aufdecken von Verbesserungspotenzial
Diese Ergebnisanforderungen erfüllen die meisten internen Audits heute noch nicht. Ein großer Teil hat nicht die Aufdeckung von Verbesserungspotenzial als Zielsetzung des Audits im Fokus, sondern die Überprüfung der Normenkonformität. Unternehmen mit reiferen Managementsystemen und solche der Automobilindustrie nutzen ggf. in ihren Audits Elemente von Prozessaudits (z. B. nach VDA 6.3). Dort wird die Erfüllung von Anforderungen nach einem Punktesystem bewertet, das den Erfüllungsgrad der Anforderung klassifiziert. Das Aufdecken von Verbesserungspotenzial wird über eine Vergrößerung der Auditstichprobe erzielt, die das Erkennen von Schwachstellen im Managementsystem und den Prozessen begünstigt.
Diese Ergebnisanforderungen erfüllen die meisten internen Audits heute noch nicht. Ein großer Teil hat nicht die Aufdeckung von Verbesserungspotenzial als Zielsetzung des Audits im Fokus, sondern die Überprüfung der Normenkonformität. Unternehmen mit reiferen Managementsystemen und solche der Automobilindustrie nutzen ggf. in ihren Audits Elemente von Prozessaudits (z. B. nach VDA 6.3). Dort wird die Erfüllung von Anforderungen nach einem Punktesystem bewertet, das den Erfüllungsgrad der Anforderung klassifiziert. Das Aufdecken von Verbesserungspotenzial wird über eine Vergrößerung der Auditstichprobe erzielt, die das Erkennen von Schwachstellen im Managementsystem und den Prozessen begünstigt.
2.2 Selbstbewertungsmodelle, Methoden und Techniken
Von TQM zu Best Practice
Institutionalisierte Methoden zur Bewertung von Spitzenleistung finden im Qualitätsmanagement heute schon Anwendung. Kein Unternehmen erbringt von heute auf morgen Spitzenleistungen. Von den ersten Schritten im Total Quality Management (TQM) bis zur Erreichung von Spitzenleistung (Best Practice) ist es ein langer und teilweise auch mühsamer Weg. Ein möglicher Weg dahin ist TQM, eine Managementphilosophie, die vom gesamten Unternehmen getragen werden muss. Für den Erfolg von TQM ist es jedoch nicht entscheidend, dass alle theoretisch denkbaren Situationen im Unternehmen festgeschrieben werden, sondern dass sich alle Mitarbeiter am Streben nach stetiger Verbesserung beteiligen. Diese Einstellung „Alle machen mit, um Bestmögliches zu erreichen”, ist im Nachhaltigkeitsgedanken ebenso zu finden. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsbegriff, für den es zurzeit keine eindeutige Methodik gibt, wie das zu messen ist, ist man im TQM schon einen Schritt weiter.
Institutionalisierte Methoden zur Bewertung von Spitzenleistung finden im Qualitätsmanagement heute schon Anwendung. Kein Unternehmen erbringt von heute auf morgen Spitzenleistungen. Von den ersten Schritten im Total Quality Management (TQM) bis zur Erreichung von Spitzenleistung (Best Practice) ist es ein langer und teilweise auch mühsamer Weg. Ein möglicher Weg dahin ist TQM, eine Managementphilosophie, die vom gesamten Unternehmen getragen werden muss. Für den Erfolg von TQM ist es jedoch nicht entscheidend, dass alle theoretisch denkbaren Situationen im Unternehmen festgeschrieben werden, sondern dass sich alle Mitarbeiter am Streben nach stetiger Verbesserung beteiligen. Diese Einstellung „Alle machen mit, um Bestmögliches zu erreichen”, ist im Nachhaltigkeitsgedanken ebenso zu finden. Im Gegensatz zum Nachhaltigkeitsbegriff, für den es zurzeit keine eindeutige Methodik gibt, wie das zu messen ist, ist man im TQM schon einen Schritt weiter.
EFQM
Hilfestellung geben den Unternehmen dabei Modelle wie das der European Foundation for Quality Management (EFQM) [13] als Weg zur Erreichung von Bestleistungen im Qualitätsmanagement. Das Modell dient zum einen zur TQM-Selbstbewertung einer Organisation, zum anderen aber auch als Grundlage der Bewertung zum European Quality Award (EQA), dem Europäischen Qualitätspreis, der alle vier Jahre vergeben wird. Ende 2019 wurde von der EFQM ein überarbeitetes Modell vorgestellt, das die Nachhaltigkeit stärker betont als die Vorgängerversion, dafür den Begriff Exzellenz nicht mehr in den Vordergrund stellt.
Hilfestellung geben den Unternehmen dabei Modelle wie das der European Foundation for Quality Management (EFQM) [13] als Weg zur Erreichung von Bestleistungen im Qualitätsmanagement. Das Modell dient zum einen zur TQM-Selbstbewertung einer Organisation, zum anderen aber auch als Grundlage der Bewertung zum European Quality Award (EQA), dem Europäischen Qualitätspreis, der alle vier Jahre vergeben wird. Ende 2019 wurde von der EFQM ein überarbeitetes Modell vorgestellt, das die Nachhaltigkeit stärker betont als die Vorgängerversion, dafür den Begriff Exzellenz nicht mehr in den Vordergrund stellt.
Sustainable Development Goals
Der Nachhaltigkeitsansatz orientiert sich dabei an der Agenda 2030 „Nachhaltige Entwicklungsziele” (Sustainable Development Goals), die auf 17 Feldern Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Menschheit formuliert. Diese Agenda haben die UN 2015 formuliert und verabschiedet. Die Ziele verfolgen den Anspruch, soziale Gleichheit herzustellen, eine wohlüberlegte Regulierung von Verantwortung und Wohlstand zu fördern und dabei auch noch den Planeten und seine Ressourcen zu schützen.
Der Nachhaltigkeitsansatz orientiert sich dabei an der Agenda 2030 „Nachhaltige Entwicklungsziele” (Sustainable Development Goals), die auf 17 Feldern Ziele der nachhaltigen Entwicklung der Menschheit formuliert. Diese Agenda haben die UN 2015 formuliert und verabschiedet. Die Ziele verfolgen den Anspruch, soziale Gleichheit herzustellen, eine wohlüberlegte Regulierung von Verantwortung und Wohlstand zu fördern und dabei auch noch den Planeten und seine Ressourcen zu schützen.
EFQM-Modell
Die Abbildung 4 zeigt das neue EFQM-Modell. Es beschreibt sieben Kriterien, die eine Organisation maximal erfüllen muss, um Spitzenleistungen (1.000 Punkte) zu erzielen. Dabei wird besonderer Wert auf den ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz gelegt.
Abb. 4: Das EFQM-Modell
Die Abbildung 4 zeigt das neue EFQM-Modell. Es beschreibt sieben Kriterien, die eine Organisation maximal erfüllen muss, um Spitzenleistungen (1.000 Punkte) zu erzielen. Dabei wird besonderer Wert auf den ganzheitlichen, unternehmensweiten Ansatz gelegt.
Drei Säulen und sieben Kriterien
Das neue Modell ist auf drei Säulen und sieben Kriterien aufgebaut. Zu den Säulen zählen:
Das neue Modell ist auf drei Säulen und sieben Kriterien aufgebaut. Zu den Säulen zählen:
Die Ausrichtungmit den beiden Kriterien „Zweck, Vision, Strategie” und „Kultur, Führung”.
Warum existiert die Organisation? Welchen Zweck erfüllt sie? Warum verfolgt sie genau die aktuelle Strategie?
Die Realisierungmit den drei Kriterien „Interessengruppen einbinden”, „nachhaltigen Nutzen schaffen” und „Leistungsfähigkeit und Transformation”
Wie beabsichtigt die Organisation, ihren Zweck zu erreichen und ihre Strategie umzusetzen?
Das Ergebnismit den beiden Kriterien „Wahrnehmung der Interessengruppen” und „Strategie und leistungsbezogene Ergebnisse”.
Was hat die Organisation erreicht? Was will sie künftig erreichen?
Hervorgehobene Aspekte
Das neue EFQM Modell hebt dabei die Bedeutung folgender Aspekte hervor:
Das neue EFQM Modell hebt dabei die Bedeutung folgender Aspekte hervor:
| • | den Vorrang des Kunden und seiner Bedürfnisse vor anderen Zielen, |
| • | die Notwendigkeit eines langfristigen, auf die Interessengruppen ausgerichteten Blickwinkels, |
| • | den Ursache-Wirkungs-Zusammenhang zwischen dem, was die Organisation tut, der Art, wie sie es tut, und was sie infolge dieser Handlungen erreicht. |
Bewertung
Jedes der sieben Kriterien untergliedert sich in mehrere Unterkriterien, die im Detail das Wesen des Kriteriums erfassen. Basis der Bewertung ist ein Prüfkatalog mit Fragen und Einstufungen zu jedem Teilkriterium, in dem nach Stärken und Verbesserungsbereichen gesucht und deren Ausprägung quantifiziert wird. Jedem der Teilkriterien ist ein maximaler (variabler) Punktwert zugeordnet, der auch eine gewisse Gewichtung der Einzelkriterien darstellt. In Summe ergeben diese Teilkriterien die vorgegebene Punktzahl des Kriteriums. Die Kriterien 1, 2, 3 und 5 haben jeweils 100 Punkte, die Kriterien 4, 6 und 7 haben 200 Punkte.
Jedes der sieben Kriterien untergliedert sich in mehrere Unterkriterien, die im Detail das Wesen des Kriteriums erfassen. Basis der Bewertung ist ein Prüfkatalog mit Fragen und Einstufungen zu jedem Teilkriterium, in dem nach Stärken und Verbesserungsbereichen gesucht und deren Ausprägung quantifiziert wird. Jedem der Teilkriterien ist ein maximaler (variabler) Punktwert zugeordnet, der auch eine gewisse Gewichtung der Einzelkriterien darstellt. In Summe ergeben diese Teilkriterien die vorgegebene Punktzahl des Kriteriums. Die Kriterien 1, 2, 3 und 5 haben jeweils 100 Punkte, die Kriterien 4, 6 und 7 haben 200 Punkte.
ISO 9004
Eine vereinfachte Version der Bewertbarkeit von TQM bietet die ISO 9004. Sie ist ein Leitfaden, der sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems betrachtet. Er enthält Anleitungen zur Ausrichtung eines Unternehmens in Richtung Total-Quality-Management (TQM), ist aber keine Zertifizierungsgrundlage. Stattdessen kann sie als Anleitung zur Selbstbewertung genutzt werden. Im Anhang gibt es dazu Listen, die zu den einzelnen Forderungen des Leitfadens konkrete Hinweise zum „Reifegrad” geben. Der Reifegrad 1 stellt die Minimalforderungen dar, Reifegrad 3 sollte von einem nach ISO 9001-zertifizierten Unternehmen, das ein in der Praxis erprobtes QMS unterhält, erreicht werden können. Der höchste Reifegrad 5 orientiert sich an der Spitzenleistung (Best Practice) im jeweiligen Sektor.
Eine vereinfachte Version der Bewertbarkeit von TQM bietet die ISO 9004. Sie ist ein Leitfaden, der sowohl die Wirksamkeit als auch die Effizienz des Qualitätsmanagementsystems betrachtet. Er enthält Anleitungen zur Ausrichtung eines Unternehmens in Richtung Total-Quality-Management (TQM), ist aber keine Zertifizierungsgrundlage. Stattdessen kann sie als Anleitung zur Selbstbewertung genutzt werden. Im Anhang gibt es dazu Listen, die zu den einzelnen Forderungen des Leitfadens konkrete Hinweise zum „Reifegrad” geben. Der Reifegrad 1 stellt die Minimalforderungen dar, Reifegrad 3 sollte von einem nach ISO 9001-zertifizierten Unternehmen, das ein in der Praxis erprobtes QMS unterhält, erreicht werden können. Der höchste Reifegrad 5 orientiert sich an der Spitzenleistung (Best Practice) im jeweiligen Sektor.
ISO 9004 – ISO 9001
Die ISO 9004 ist eher das „Managementdesign”, also ein Managementmodell und kein eigenes Managementsystem. Die konkrete Umsetzung der ISO 9004 entspricht im Grundsatz dem EFQM-Modell, das auch keine Norm ist, sondern ein umfassendes ganzheitliches Qualitätsmanagement im Sinne von TQM ist. Gegenüber dem EFQM-Modell hat die ISO 9004 den Vorteil, dass sie als Prüfgrundlage die ISO 9001 und deren Anforderungen weitgehend mit einbezieht. Auch wenn sie in der Kapitelstruktur nicht vollständig mit der ISO 9001 kompatibel ist, lassen sich dennoch gemeinsame Strukturen und Anforderungen transparent zuordnen.
Die ISO 9004 ist eher das „Managementdesign”, also ein Managementmodell und kein eigenes Managementsystem. Die konkrete Umsetzung der ISO 9004 entspricht im Grundsatz dem EFQM-Modell, das auch keine Norm ist, sondern ein umfassendes ganzheitliches Qualitätsmanagement im Sinne von TQM ist. Gegenüber dem EFQM-Modell hat die ISO 9004 den Vorteil, dass sie als Prüfgrundlage die ISO 9001 und deren Anforderungen weitgehend mit einbezieht. Auch wenn sie in der Kapitelstruktur nicht vollständig mit der ISO 9001 kompatibel ist, lassen sich dennoch gemeinsame Strukturen und Anforderungen transparent zuordnen.
Integrierte Umsetzung
Aufgrund der großen Kompatibilität von ISO 9004 und ISO 9001 sind auch Synergien zwischen der Selbstbewertungsmethodik gemäß ISO 9004 und der Anforderung nach internen Audits der ISO 9001 vorhanden. Beide Bewertungsmodelle könnten in einem Verfahren gemeinsam umgesetzt werden. Das fünfstufige Bewertungsverfahren der ISO 9004 muss dazu um ein weiteres Bewertungskriterium, die Nichtkonformität mit einer Normenforderung, erweitert werden. Die Öffnung der Reifegradstufen hinsichtlich einer Erweiterung ist gemäß Anhang A.2 der ISO 9004 auch vorgesehen. Der Reifegrad 0 ist nicht vergeben und könnte für die Nichterfüllung einer Normenforderung (Abweichung) genutzt werden.
Aufgrund der großen Kompatibilität von ISO 9004 und ISO 9001 sind auch Synergien zwischen der Selbstbewertungsmethodik gemäß ISO 9004 und der Anforderung nach internen Audits der ISO 9001 vorhanden. Beide Bewertungsmodelle könnten in einem Verfahren gemeinsam umgesetzt werden. Das fünfstufige Bewertungsverfahren der ISO 9004 muss dazu um ein weiteres Bewertungskriterium, die Nichtkonformität mit einer Normenforderung, erweitert werden. Die Öffnung der Reifegradstufen hinsichtlich einer Erweiterung ist gemäß Anhang A.2 der ISO 9004 auch vorgesehen. Der Reifegrad 0 ist nicht vergeben und könnte für die Nichterfüllung einer Normenforderung (Abweichung) genutzt werden.
2.3 Strukturen eines IMS unter Einbeziehung der ISO 9004
High Level Structure
Da seit 2015, neben der ISO 9001, auch weitere wesentliche Zertifizierungsnormen (z. B. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) gemäß der High Level Structure (HLS) gegliedert sind, können deren Anforderungen wie die der ISO 9001 auch der ISO 9004 leichter zugeordnet werden. Alle Zertifizierungsnormen von Managementsystemen der ISO, so auch die ISO 9001, folgen der HLS
Da seit 2015, neben der ISO 9001, auch weitere wesentliche Zertifizierungsnormen (z. B. ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) gemäß der High Level Structure (HLS) gegliedert sind, können deren Anforderungen wie die der ISO 9001 auch der ISO 9004 leichter zugeordnet werden. Alle Zertifizierungsnormen von Managementsystemen der ISO, so auch die ISO 9001, folgen der HLS
Strukturvergleich
Die Struktur der ISO 9004 (vgl. Abbildung 5) folgt nicht in Gänze der Qualitätsnorm ISO 9001, sondern weicht davon ab, obwohl die managementsystemrelevanten Anforderungen in der ISO 9001 weitgehend in der ISO 9004 abgebildet sind, ggf. aber in anderen Unterkapiteln.
Abb. 5: Struktur der ISO 9004
Die Struktur der ISO 9004 (vgl. Abbildung 5) folgt nicht in Gänze der Qualitätsnorm ISO 9001, sondern weicht davon ab, obwohl die managementsystemrelevanten Anforderungen in der ISO 9001 weitgehend in der ISO 9004 abgebildet sind, ggf. aber in anderen Unterkapiteln.
Die Struktur der ISO 9004 hat elf Hauptkapitel und somit ein Hauptkapitel mehr als die ISO 9001. Außerdem sind im Anhang A der ISO 9004 die Methodik der Selbstbewertung und der dazu benötigte Kriterienkatalog beschrieben. Die Abbildung 6 gibt im Vergleich dazu die Struktur der ISO 9001 wieder.
Abb. 6: Struktur der ISO 9001
Unterschiede
Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Normen 9001 und 9004 bestehen in den Anforderungen der Normkapitel 6 und 8. In ihnen sind die Anforderungen der spezifischen Fachnorm ISO 9001 enthalten. Unterschiede in den Themen der Hauptkapitel zwischen ISO 9001 und ISO 9004 sind:
Deutliche Unterschiede zwischen den beiden Normen 9001 und 9004 bestehen in den Anforderungen der Normkapitel 6 und 8. In ihnen sind die Anforderungen der spezifischen Fachnorm ISO 9001 enthalten. Unterschiede in den Themen der Hauptkapitel zwischen ISO 9001 und ISO 9004 sind:
| • | Qualität und Erfolg, Normkapitel 4 der ISO 9004 |
| • | Identität der Organisation, Normkapitel 6 der ISO 9004 |
Beide Normkapitel haben in der ISO 9001 keine Entsprechung. Es gibt in der ISO 9001 auch kein Kapitel Prozessmanagement (Normkapitel 8); das ist in der ISO 9001 mit den Kernprozessen der betrieblichen Leistungserstellung (Betrieb) belegt. Das Thema Prozesse ist in der ISO 9001 in Normkapitel 4.4 „QM-System und seine Prozesse” beschrieben. In der ISO 9004 ist das Thema in Normkapitel 8 wesentlich detaillierter ausgeführt. Ebenfalls mehr Detailierungstiefe bietet das Normkapitel 10 der ISO 9004 „Bewertung der Leistung”. Die Darlegungen in den Normkapiteln Leistungsindikatoren (Kennzahlen), Leistungsanalyse und Leistungsbewertung gehen deutlich über die Regelungen der ISO 9001 hinaus.
Nachhaltigkeitsthemen
Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen hat die ISO 9004 auch mehr Anknüpfungspunkte als die ISO 9001 zu bieten. Das Normkapitel 4 sagt aus, dass neben den Anforderungen und Erwartungen der Kunden auch die Erwartungen anderer interessierter Parteien zu berücksichtigen sind. Dazu gehören dann interessierte Parteien aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Kein Unternehmen existiert für sich allein, sondern ist eingebettet in lokale, regionale und globale Strukturen, mit denen es in Interaktionen tritt. Normativ ist das in der Beschreibung des Kontexts festgelegt.
Im Hinblick auf Nachhaltigkeitsthemen hat die ISO 9004 auch mehr Anknüpfungspunkte als die ISO 9001 zu bieten. Das Normkapitel 4 sagt aus, dass neben den Anforderungen und Erwartungen der Kunden auch die Erwartungen anderer interessierter Parteien zu berücksichtigen sind. Dazu gehören dann interessierte Parteien aus Wirtschaft, Umwelt und Gesellschaft. Kein Unternehmen existiert für sich allein, sondern ist eingebettet in lokale, regionale und globale Strukturen, mit denen es in Interaktionen tritt. Normativ ist das in der Beschreibung des Kontexts festgelegt.
Selbstbild des Unternehmens
Im Normkapitel 6 wird mit Themen wie Mission, Vision, Werte und Kultur eines Unternehmens das Selbstbild eines Unternehmens angesprochen mit Fragen wie:
Im Normkapitel 6 wird mit Themen wie Mission, Vision, Werte und Kultur eines Unternehmens das Selbstbild eines Unternehmens angesprochen mit Fragen wie:
| • | Wer sind wir, wer wollen wir sein? |
| • | Wohin wollen wir und mit welchen Mitteln? |
| • | Welchen Stellenwert nehmen Mitarbeiter und Menschen ein? |
| • | Was bedeutet uns Umwelt- und Ressourcenschonung? |
| • | Wie stehen wir zur Klimaneutralität? |
Das alles und ggf. noch mehr sind Fragestellungen, die im Kontext der Nachhaltigkeit auf betrieblicher Ebene zu stellen sind. In dieselbe Richtung zielt das Normkapitel 9.7 „Natürliche Ressourcen” und deren Verbrauch, das den Umweltgedanken der Nachhaltigkeit bedient.
Als Arbeitshilfe beigefügt ist eine Verweismatrix zwischen den Anforderungen der ISO 9001 und den Anleitungen der ISO 9004. Sie macht die Gemeinsamkeiten, aber auch die Unterschiede zwischen den beiden Regelwerken deutlich.[ 06304_b.xlsx]
06304_b.xlsx]
 06304_b.xlsx]
06304_b.xlsx]Um die Anforderungen der anderen betrachteten Systemnormen des integrierten Managementsystems, etwa ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001, in Beziehung zur ISO 9004 zu setzen, ist es sinnvoll, die ISO 9001 als Transfernorm zu benutzen. Die Beziehung der Qualitätsnorm zu den anderen Managementsystemen, etwa der ISO 14001 oder ISO 50001, ist durch die HLS mittels Verweismatrix definiert. Über die Verweismatrix der ISO 9001 zur ISO 9004 sind die anderen Managementsystemnormen des IMS in die Struktur der ISO 9004 zu überführen – wobei nicht jedes Normenkapitel eine Entsprechung in der ISO 9004 haben muss.
Als Arbeitshilfe beigefügt ist eine Verweismatrix zwischen den vergleichbaren Anforderungen der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Aus der Arbeitshilfe zu entnehmen sind auch die Themenstellungen, die spezifisch für das einzelne Managementsystem sind und in den anderen Systemen keine Entsprechung haben, z. B. Umweltaspekte in der ISO 14001 oder Kundenzufriedenheit in der ISO 9001.[ 06304_c.xlsx]
06304_c.xlsx]
 06304_c.xlsx]
06304_c.xlsx]Selbstbewertungsmethodik
Die ISO 9004 beschreibt im Grundsatz auch eine Selbstbewertungsmethodik (Normkapitel 10.6). Diese ist als dritte Säule der Überprüfung eines integrierten Managementsystems neben dem internen Audit (Normkapitel 10.5) und der Managementbewertung (Normkapitel 10.7 „Überprüfung”) hinzugekommen – wobei die Managementbewertung in diesem Fall die Ergebnisse des internen Audits und der Selbstbewertung berücksichtigten soll. Um Ressourcen zur Überwachung des integrierten Managementsystems zu schonen, wird in den folgenden Abschnitten gezeigt, wie man internes Audit und Selbstbewertung unter einen Hut, sprich in einen integrierten Prozess, bekommen kann.
Die ISO 9004 beschreibt im Grundsatz auch eine Selbstbewertungsmethodik (Normkapitel 10.6). Diese ist als dritte Säule der Überprüfung eines integrierten Managementsystems neben dem internen Audit (Normkapitel 10.5) und der Managementbewertung (Normkapitel 10.7 „Überprüfung”) hinzugekommen – wobei die Managementbewertung in diesem Fall die Ergebnisse des internen Audits und der Selbstbewertung berücksichtigten soll. Um Ressourcen zur Überwachung des integrierten Managementsystems zu schonen, wird in den folgenden Abschnitten gezeigt, wie man internes Audit und Selbstbewertung unter einen Hut, sprich in einen integrierten Prozess, bekommen kann.
Es werden zur Themenorientierung zu den einzelnen Punkten der Abschnitte 3 bis 10 des Beitrags aber nur die Kernforderungen der Normen aufgeführt. Der Verweis auf die entsprechende Norm z. B. ISO 9001 Normkapitel 9.2, Internes Audit, gibt den Bezug zu den vollständigen Anforderungen, die dieses Kapitel betreffen. Diese sind bei der Selbstbewertung entsprechend zu berücksichtigen. Die Kapitelstruktur der ISO 9004 wurde thematisch den Normkapiteln 4 bis 10 zugeordnet und in die HLS der ISO 9001 integriert. Alle Inhalte, die nicht thematisch der ISO 9001 zugordnet werden können, sind im Normkapitel 3 „Wesen der Organisation” untergebracht.
Normenzuordnung in den folgenden Abschnitten
Um die Zuordnung zu den einzelnen spezifischen Normen zu erleichtern, wurden die Normenbezüge in den Unterabschnitten des Beitrags angegeben. Die Bezeichnung IMS steht für vergleichbare Normenforderungen in den genannten Kapiteln der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Bezug: 9004/4.1 z. B. steht im Weiteren für die Inhalte der ISO 9004 in Normabschnitt 4.1. Das Kürzel IMS steht dabei dann immer für die jeweiligen gleichartigen Normkapitel von ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 als Gesamtheit.
Um die Zuordnung zu den einzelnen spezifischen Normen zu erleichtern, wurden die Normenbezüge in den Unterabschnitten des Beitrags angegeben. Die Bezeichnung IMS steht für vergleichbare Normenforderungen in den genannten Kapiteln der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001. Bezug: 9004/4.1 z. B. steht im Weiteren für die Inhalte der ISO 9004 in Normabschnitt 4.1. Das Kürzel IMS steht dabei dann immer für die jeweiligen gleichartigen Normkapitel von ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 als Gesamtheit.
3.1 Güte der Organisation
Bezug: 9004/4.1
Der Begriff Güte wird in der ISO 9004 auch mit dem Begriff Qualität einer Organisation belegt. Der Qualitätsbegriff wird hier aber im Kontext verwendet, inwieweit innewohnende (inhärente) Merkmale einer Organisation in der Lage sind, die Anforderungen und Erwartungen der interessierten Parteien (inkl. Kunden) zu erfüllen. Zu den Merkmalen gehören Organisation, Prozesse, Strategie, Kompetenz und Weiteres, die die Organisation benötigt, um nachhaltigen Erfolg zu realisieren. Die Organisation muss selbst bestimmen, was davon für sie zum Erreichen des nachhaltigen Erfolgs relevant ist. Dabei hat sie die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien (vgl. Abbildung 7) und deren Veränderungen mit der Zeit zu berücksichtigen.
Abb. 7: Beispiel möglicher interessierter Parteien
Der Begriff Güte wird in der ISO 9004 auch mit dem Begriff Qualität einer Organisation belegt. Der Qualitätsbegriff wird hier aber im Kontext verwendet, inwieweit innewohnende (inhärente) Merkmale einer Organisation in der Lage sind, die Anforderungen und Erwartungen der interessierten Parteien (inkl. Kunden) zu erfüllen. Zu den Merkmalen gehören Organisation, Prozesse, Strategie, Kompetenz und Weiteres, die die Organisation benötigt, um nachhaltigen Erfolg zu realisieren. Die Organisation muss selbst bestimmen, was davon für sie zum Erreichen des nachhaltigen Erfolgs relevant ist. Dabei hat sie die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien (vgl. Abbildung 7) und deren Veränderungen mit der Zeit zu berücksichtigen.
Die Güte (Qualität) der Organisation bezüglich des nachhaltigen Erfolgs wird mit dem Gesamtreifegrad des IMS bewertet (höchster Reifegrad 5 „Beste Praktiken”).
3.2 Leiten zum nachhaltigen Erfolg
Bezug: 9004/4.2
Die Leitung der Organisation kann nur nachhaltigen Erfolg erzielen, wenn sie langfristig die Erfordernisse und Erwartungen aller wesentlichen interessierten Parteien erfüllt, auch jener, mit denen sie im Rahmen des allgemeinen Geschäfts keinen direkten Kontakt hat, die aber z. B. auf das Markt- sowie Produkt-/Dienstleistungsimage des Unternehmens Einfluss nehmen können. Grundlage dafür ist eine für alle interessierten Parteien verständliche Mission des Unternehmens (Warum sind wir da?), die mit einer klaren Vision (Wohin wollen wir?) untersetzt ist. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Unternehmen für sich und im Umgang mit anderen einen Wertekanon vorgibt, diesen lebt und darüber nach innen wie nach außen kommuniziert.
Die Leitung der Organisation kann nur nachhaltigen Erfolg erzielen, wenn sie langfristig die Erfordernisse und Erwartungen aller wesentlichen interessierten Parteien erfüllt, auch jener, mit denen sie im Rahmen des allgemeinen Geschäfts keinen direkten Kontakt hat, die aber z. B. auf das Markt- sowie Produkt-/Dienstleistungsimage des Unternehmens Einfluss nehmen können. Grundlage dafür ist eine für alle interessierten Parteien verständliche Mission des Unternehmens (Warum sind wir da?), die mit einer klaren Vision (Wohin wollen wir?) untersetzt ist. Darüber hinaus ist es wichtig, dass das Unternehmen für sich und im Umgang mit anderen einen Wertekanon vorgibt, diesen lebt und darüber nach innen wie nach außen kommuniziert.
Ziele der Organisation
Um den nachhaltigen Erfolg zu erreichen, muss die Organisation wirksame Instrumente entwickeln und anwenden, um aus der Vision eine praktikable Unternehmenspolitik zu entwickeln, die mittels Strategie und Zielen die kontinuierliche Realisierung der Vision ermöglicht. Unabdingbar dafür sind optimierte Geschäftsprozesse sowie deren Überwachung und Steuerung. Die Bewertungsmethodik der ISO 9004 stellt dafür ein geeignetes Instrument zur Verfügung. Die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen und deren gezielter Einsatz sind die materielle Voraussetzung, die Ziele der Organisation zu erreichen.
Um den nachhaltigen Erfolg zu erreichen, muss die Organisation wirksame Instrumente entwickeln und anwenden, um aus der Vision eine praktikable Unternehmenspolitik zu entwickeln, die mittels Strategie und Zielen die kontinuierliche Realisierung der Vision ermöglicht. Unabdingbar dafür sind optimierte Geschäftsprozesse sowie deren Überwachung und Steuerung. Die Bewertungsmethodik der ISO 9004 stellt dafür ein geeignetes Instrument zur Verfügung. Die Bereitstellung von ausreichenden Ressourcen und deren gezielter Einsatz sind die materielle Voraussetzung, die Ziele der Organisation zu erreichen.
3.3 Identität einer Organisation
Bezug: 9004/6.2
Die Identität einer Organisation ist abhängig von der Mission, ihren Werten und der Kultur auf der einen Seite und von ihrem Kontext auf der anderen Seite. Alle die Identität beeinflussenden Faktoren haben wechselseitige Beziehungen und sind dynamisch im Hinblick auf zeitliche Veränderungen.
Die Identität einer Organisation ist abhängig von der Mission, ihren Werten und der Kultur auf der einen Seite und von ihrem Kontext auf der anderen Seite. Alle die Identität beeinflussenden Faktoren haben wechselseitige Beziehungen und sind dynamisch im Hinblick auf zeitliche Veränderungen.
Werte, Vision, Mission → Politik
Daher soll die oberste Leitung der Organisation Vision, Werte und Kultur in geplanten Abständen und bei jeder wesentlichen Veränderung des Kontexts überprüfen. Die IMS-Politik und die strategische Ausrichtung der Organisation sollten mit den Elementen der Identität bei Veränderung abgestimmt werden. Der letzte Schritt besteht in der Anpassung der Ziele an die geänderte Politik und Strategie. Eine Zuordnung der Begriffe Werte, Vision und Mission zur Politik und zu den Zielen aus den ISO-Normen zeigt Abbildung 8.
Abb. 8: Zuordnung Werte, Vision, Mission zur Politik
Daher soll die oberste Leitung der Organisation Vision, Werte und Kultur in geplanten Abständen und bei jeder wesentlichen Veränderung des Kontexts überprüfen. Die IMS-Politik und die strategische Ausrichtung der Organisation sollten mit den Elementen der Identität bei Veränderung abgestimmt werden. Der letzte Schritt besteht in der Anpassung der Ziele an die geänderte Politik und Strategie. Eine Zuordnung der Begriffe Werte, Vision und Mission zur Politik und zu den Zielen aus den ISO-Normen zeigt Abbildung 8.
Der Schriftsteller Mark Twain hat einmal gesagt „Wer nicht weiß, wohin er will, darf sich nicht wundern, wenn er woanders ankommt.” Diese einfache Feststellung gilt auch für Organisationen und Unternehmen. Der Zweck, nur Geld zu verdienen, macht aus einem Unternehmen noch kein erfolgreiches und erst recht kein nachhaltiges Unternehmen.
Steuerungsinstrumente
Das Leitbild mit seinen Themen Werte, Mission und Vision ist das langfristige Steuerungsinstrument für die Zukunftsausrichtung der Organisation. Die Politik mit der Strategie und den Zielen ist das kurz- bis mittelfristige Element der Organisationssteuerung zur Umsetzung des operativen Geschäfts. Eine erfolgreiche und nachhaltige Organisation benötigt beide Elemente in ihrem Wirkzusammenhang.
Das Leitbild mit seinen Themen Werte, Mission und Vision ist das langfristige Steuerungsinstrument für die Zukunftsausrichtung der Organisation. Die Politik mit der Strategie und den Zielen ist das kurz- bis mittelfristige Element der Organisationssteuerung zur Umsetzung des operativen Geschäfts. Eine erfolgreiche und nachhaltige Organisation benötigt beide Elemente in ihrem Wirkzusammenhang.
Welche Bedeutung die einzelnen Begriffe haben, wird nachfolgend erläutert:
Kultur
Die Grundwerte einer Organisation bilden die vorherrschende Kultur. Es geht um das gelebte Miteinander innerhalb der Organisation, aber auch mit Kunden und Lieferanten. Das Ergebnis einer positiven Kultur ist das Wohlfühlen von Menschen in der Organisation und das Bewusstsein der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Die Kultur ist Basis für alles.
Die Grundwerte einer Organisation bilden die vorherrschende Kultur. Es geht um das gelebte Miteinander innerhalb der Organisation, aber auch mit Kunden und Lieferanten. Das Ergebnis einer positiven Kultur ist das Wohlfühlen von Menschen in der Organisation und das Bewusstsein der Sinnhaftigkeit ihres Tuns. Die Kultur ist Basis für alles.
Vision
Die Vision beschreibt den idealen Zustand der Organisation in einer entfernten Zukunft. Was will die Organisation bei konsequentem Leben der Mission z. B. in zehn Jahren erreichen? Sie entfaltet ihre Wirkung in der Organisation hauptsächlich nach innen und gibt langfristige Orientierung.
Die Vision beschreibt den idealen Zustand der Organisation in einer entfernten Zukunft. Was will die Organisation bei konsequentem Leben der Mission z. B. in zehn Jahren erreichen? Sie entfaltet ihre Wirkung in der Organisation hauptsächlich nach innen und gibt langfristige Orientierung.
Mission
Die Mission richtet sich im Gegensatz zur Vision hauptsächlich nach außen. Sie legt fest, auf welche Art und Weise die Organisation ihrer Vision erreichen möchte. Die Mission ist dabei an der Identität einer Organisation z. B. als einer Marke (Brand) ausgerichtet.
Die Mission richtet sich im Gegensatz zur Vision hauptsächlich nach außen. Sie legt fest, auf welche Art und Weise die Organisation ihrer Vision erreichen möchte. Die Mission ist dabei an der Identität einer Organisation z. B. als einer Marke (Brand) ausgerichtet.
Leitbild
Werte, Vision und Mission werden auch häufig unter dem Begriff Leitbild einer Organisation zusammengefasst. Die Politik stellt das Bindeglied zwischen dem Leitbild und der Managementsystemebene dar.
Werte, Vision und Mission werden auch häufig unter dem Begriff Leitbild einer Organisation zusammengefasst. Die Politik stellt das Bindeglied zwischen dem Leitbild und der Managementsystemebene dar.
Politik
Die Managementpolitik eines IMS ist die Übersetzung des langfristigen Leitbilds in mittelfristige Vorgaben, um diese durch Regelungen in operative Arbeit umzusetzen. Dabei sind neben den Ausrichtungen aus dem Leitbild auch ergänzende Forderungen aus den spezifischen Managementsystemnormen wie z. B. Rechtskonformität, oder Kundenzufriedenheit zu berücksichtigen.
Die Managementpolitik eines IMS ist die Übersetzung des langfristigen Leitbilds in mittelfristige Vorgaben, um diese durch Regelungen in operative Arbeit umzusetzen. Dabei sind neben den Ausrichtungen aus dem Leitbild auch ergänzende Forderungen aus den spezifischen Managementsystemnormen wie z. B. Rechtskonformität, oder Kundenzufriedenheit zu berücksichtigen.
Strategie
Die Strategie umfasst die langfristigen Unternehmenszielstellungen (strategische Ziele) um Mission und Politik in die Realität zu überführen. Dazu dienen im Detail die operativen Ziele und die zu deren Umsetzung erstellten Aktionspläne.
Die Strategie umfasst die langfristigen Unternehmenszielstellungen (strategische Ziele) um Mission und Politik in die Realität zu überführen. Dazu dienen im Detail die operativen Ziele und die zu deren Umsetzung erstellten Aktionspläne.
4.1.1 Allgemeines
Bezug: IMS/4.1 und 9004/5.1
Anmerkung: IMS steht für die ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001.
Anmerkung: IMS steht für die ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001.
Das Verstehen des Kontexts bezieht sich auf die internen und externen Themen der Organisation, die im Wesentlichen durch die interessierten Parteien bestimmt werden. Dabei ist zu berücksichtigen, dass in einem IMS der Kontext für die Einzelsysteme, z. B. ISO 9001 oder ISO 14001, unterschiedlich sein kann. Was für den Kontext gilt, gilt auch für die interessierten Parteien; auch sie können je nach Managementsystem unterschiedlich sein (z. B. Behörden bei der ISO 14001). Es besteht ebenso die Möglichkeit, dass die interessierten Parteien in mehreren spezifischen Managementsystemen die gleichen sind, aber ihre Anforderungen an die Organisation je nach Managementsystem verschieden ausfallen. So kann in der ISO 9001 eine schnelle Dienstleistungserbringung eine wichtige Kundenanforderung sein und in der ISO 14001, ebenso ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz (Stichwort: klimaneutrale Organisation).
4.1.2 Interne und externe Themen
Bezug: IMS/4.1 und 9004/5.3.1 und 5.3.2
Externe Themen sind Themen, die von außen auf die Organisation einwirken und deren Fähigkeit zum nachhaltigen Erfolg wesentlich beeinflussen können. Dazu gehören gesetzliche Anforderungen genauso wie der Wettbewerb oder soziale, gesellschaftliche, politische und umweltspezifische Themen.
Externe Themen sind Themen, die von außen auf die Organisation einwirken und deren Fähigkeit zum nachhaltigen Erfolg wesentlich beeinflussen können. Dazu gehören gesetzliche Anforderungen genauso wie der Wettbewerb oder soziale, gesellschaftliche, politische und umweltspezifische Themen.
Interne Themen sind Faktoren, die aus dem Wirken der Organisation entstehen und ebenso die Möglichkeiten zum nachhaltigen Erfolg, positiv wie negativ, verändern können. Das können z. B. sein, Art der Produkte/Dienstleistungen, Ressourcenbereitstellung, Prozessfähigkeit oder Innovationsvermögen.
Risiken oder Chancen
Nach der Bestimmung der internen/externen Themen muss die Organisation die bestimmen, die Risiken oder Chancen enthalten, um diese im Normkapitel 6.1 „Umgang mit Risiken und Chancen (IMS)” weiter zu behandeln.
Nach der Bestimmung der internen/externen Themen muss die Organisation die bestimmen, die Risiken oder Chancen enthalten, um diese im Normkapitel 6.1 „Umgang mit Risiken und Chancen (IMS)” weiter zu behandeln.
Für externe und interne Themen gilt gleichermaßen im IMS die Forderung nach der vollständigen Erfassung und Bewertung sowie regelmäßiger Überprüfung des Kontexts. Darüber sind dokumentierte Informationen zu erstellen und aufzubewahren.
4.2 Relevante interessierte Parteien
Bezug: IMS/4.2 und 9004/5.2
Interessierte Parteien können Entscheidungen der Organisation mehr oder weniger beeinflussen. Sie können umgekehrt aber auch von Entscheidungen der Organisation betroffen sein oder sich betroffen fühlen, was ggf. zu Reaktionen führen kann, die den nachhaltigen Erfolg der Organisation gefährden. Interessierte Parteien können internen wie externen Charakter haben. Die Abbildung 9 zeigt eine Auswahl interessierter Parteien.
Abb. 9: Beispiele für interne/externe interessierte Parteien
Interessierte Parteien können Entscheidungen der Organisation mehr oder weniger beeinflussen. Sie können umgekehrt aber auch von Entscheidungen der Organisation betroffen sein oder sich betroffen fühlen, was ggf. zu Reaktionen führen kann, die den nachhaltigen Erfolg der Organisation gefährden. Interessierte Parteien können internen wie externen Charakter haben. Die Abbildung 9 zeigt eine Auswahl interessierter Parteien.
Bei den externen interessierten Parteien sollte Mutter Erde und ihre Anforderungen an nachhaltiges Wirtschaften durch den Menschen nicht vergessen werden.
Erfassen und bewerten
Die Organisation muss die interessierten Parteien und deren Anforderungen und Erwartungen ermitteln und bewerten im Hinblick auf deren Bedeutung, den nachhaltigen Erfolg der Organisation zu beeinflussen. Erfassung und Bewertung sind in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Darüber hinaus sind Prozesse des Umgangs mit den interessierten Parteien (ggf. abgestuft nach Bedeutung) festzulegen.
Die Organisation muss die interessierten Parteien und deren Anforderungen und Erwartungen ermitteln und bewerten im Hinblick auf deren Bedeutung, den nachhaltigen Erfolg der Organisation zu beeinflussen. Erfassung und Bewertung sind in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren. Darüber hinaus sind Prozesse des Umgangs mit den interessierten Parteien (ggf. abgestuft nach Bedeutung) festzulegen.
Nach der Bewertung der interessierten Parteien muss die Organisation bestimmen, welche davon Risiken oder Chancen enthalten, um diese im Normkapitel 6.1 „Umgang mit Risiken und Chancen (IMS)” weiter zu behandeln.
Beziehungen aufbauen
Die Organisation sollte zu wesentlichen interessierten Parteien dauerhafte Beziehungen aufbauen, um Nutzen aus einer abgestimmten Vorgehensweise zu ziehen, die auf einem gemeinsamen Verständnis von nachhaltigem Handeln beruht.
Die Organisation sollte zu wesentlichen interessierten Parteien dauerhafte Beziehungen aufbauen, um Nutzen aus einer abgestimmten Vorgehensweise zu ziehen, die auf einem gemeinsamen Verständnis von nachhaltigem Handeln beruht.
4.3.1 Anwendungsbereich der Managementsysteme
Bezug: IMS/4.3
Der Anwendungsbereich eines spezifischen Managementsystems ist jeweils im Normabschnitt 4.3 der hier betrachteten Normen festgelegt. Er umfasst
Der Anwendungsbereich eines spezifischen Managementsystems ist jeweils im Normabschnitt 4.3 der hier betrachteten Normen festgelegt. Er umfasst
| • | den Kontext mit seinen externen und internen Themen, |
| • | die Anforderungen und Erwartungen der relevanten interessierten Parteien, |
| • | die eingeschlossenen Prozesse (Produktion und Dienstleistung) und |
| • | die eingeschlossene(n) Organisation(en) und Standorte. |
Der Anwendungsbereich muss als dokumentierte Information (aktuell) verfügbar sein. Ausschlüsse von der Norm und deren Einschränkungen sind nur dann zulässig, wenn die Wirksamkeit der Managementsysteme insgesamt gewährleistet bleibt.
4.3.2 Grenzen des Nachhaltigkeitsmanagements
Nur eingeschränkt möglich
Der Anwendungsbereich bei normativen Anforderungen wird durch die spezifischen Normen des IMS klar geregelt. Beim Nachhaltigkeitsmanagement gibt es diese normativen Vorgaben nicht. Zentrale Vorgaben wären hinsichtlich der Breite der Nachhaltigkeitsthemen für einzelne Organisation auch häufig nichtzutreffend, da sie von der Organisation nur unzureichend oder gar nicht beeinflussbar sind (z. B. Kinderarbeit), wenn sich die Tätigkeiten der Organisation nur auf Deutschland konzentrieren.
Der Anwendungsbereich bei normativen Anforderungen wird durch die spezifischen Normen des IMS klar geregelt. Beim Nachhaltigkeitsmanagement gibt es diese normativen Vorgaben nicht. Zentrale Vorgaben wären hinsichtlich der Breite der Nachhaltigkeitsthemen für einzelne Organisation auch häufig nichtzutreffend, da sie von der Organisation nur unzureichend oder gar nicht beeinflussbar sind (z. B. Kinderarbeit), wenn sich die Tätigkeiten der Organisation nur auf Deutschland konzentrieren.
Freiwillige Anforderungen
Mindestens wären die Grenzen des Nachhaltigkeitsmanagements mit den normativen Anforderungen der Managementsysteme, die im IMS der Organisation vereint sind, deckungsgleich. Jeder Organisation ist es aber möglich darüber hinaus weitere Nachhaltigkeitsthemen freiwillig in das IMS zu integrieren. Am einfachsten ist die Übernahme von einzelnen Themenfeldern aus etablierten Nachhaltigkeitsmodellen, wie dem Global Compact oder dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. In Form von internen Prozessen können Anforderungen zu diesen Nachhaltigkeitsthemen intern formuliert und für die Organisation für verbindlich erklärt werden. Sie wären dann automatisch Bestandteil der internen Systemprüfung durch das Reifegradmodell der ISO 9004, auch ohne durch Anforderungen einer spezifischen Managementsystemnorm abgedeckt zu werden.
Mindestens wären die Grenzen des Nachhaltigkeitsmanagements mit den normativen Anforderungen der Managementsysteme, die im IMS der Organisation vereint sind, deckungsgleich. Jeder Organisation ist es aber möglich darüber hinaus weitere Nachhaltigkeitsthemen freiwillig in das IMS zu integrieren. Am einfachsten ist die Übernahme von einzelnen Themenfeldern aus etablierten Nachhaltigkeitsmodellen, wie dem Global Compact oder dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex. In Form von internen Prozessen können Anforderungen zu diesen Nachhaltigkeitsthemen intern formuliert und für die Organisation für verbindlich erklärt werden. Sie wären dann automatisch Bestandteil der internen Systemprüfung durch das Reifegradmodell der ISO 9004, auch ohne durch Anforderungen einer spezifischen Managementsystemnorm abgedeckt zu werden.
4.4.1 Allgemeines
Bezug: IMS/4.4 und 9004/8.1
In der Regel werden in Organisationen Prozesse zur strukturierten Umsetzung von Tätigkeiten und Vorgängen eingesetzt. Diese Prozesse können wertschöpfend sein, also einen Mehrwert in Form von Produkten oder Dienstleistungen erzeugen, oder andere Themen mit Anforderungen an die Organisation regeln wie z. B. rechtliche Anforderungen. Letztlich gehören dazu auch Prozesse, die die interne Funktionsfähigkeit einer Organisation ausmachen, wie Kompetenz oder dokumentierte Information. Im Rahmen möglicher Beeinflussung sind auch ausgelagerte oder extern zugelieferte Prozesse in das Prozessmanagement der Organisation einzubeziehen.
In der Regel werden in Organisationen Prozesse zur strukturierten Umsetzung von Tätigkeiten und Vorgängen eingesetzt. Diese Prozesse können wertschöpfend sein, also einen Mehrwert in Form von Produkten oder Dienstleistungen erzeugen, oder andere Themen mit Anforderungen an die Organisation regeln wie z. B. rechtliche Anforderungen. Letztlich gehören dazu auch Prozesse, die die interne Funktionsfähigkeit einer Organisation ausmachen, wie Kompetenz oder dokumentierte Information. Im Rahmen möglicher Beeinflussung sind auch ausgelagerte oder extern zugelieferte Prozesse in das Prozessmanagement der Organisation einzubeziehen.
Alle diese Prozesse bilden ein Netzwerk, bei dem es auch zu Interaktionen kommen kann. Um diese Prozesse funktionsfähig zu halten und zu verbessern, sind die Zuteilung von ausreichenden Ressourcen und die stetige Verbesserung der Prozesse mit dem Ziel Erreichung von Best Practice, notwendig.
4.4.2 Bestimmen der Prozesse
Bezug: IMS/4.4 und 9004/8.2
Um ein wirksames Prozessmanagement betreiben zu können, muss die Organisation ihre Prozesse identifizieren und ihre Wechselwirkungen bestimmen. Dabei sind nicht nur die eigenen Anforderungen zu berücksichtigen, sondern, wenn relevant, auch die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien. Bei der Gestaltung der Prozesse sollten Politik und Strategie der Organisation berücksichtigt werden sowie die Risiken und Chancen, die ein positives Ergebnis der Prozesse gefährden oder unterstützen können. Die Abbildung 10 zeigt mögliche Elemente eines Prozesses.
Abb. 10: Schematische Darstellung eines Prozesses
Um ein wirksames Prozessmanagement betreiben zu können, muss die Organisation ihre Prozesse identifizieren und ihre Wechselwirkungen bestimmen. Dabei sind nicht nur die eigenen Anforderungen zu berücksichtigen, sondern, wenn relevant, auch die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien. Bei der Gestaltung der Prozesse sollten Politik und Strategie der Organisation berücksichtigt werden sowie die Risiken und Chancen, die ein positives Ergebnis der Prozesse gefährden oder unterstützen können. Die Abbildung 10 zeigt mögliche Elemente eines Prozesses.
Kern-, Unterstützungs- und Führungsprozesse
Die identifizierten Prozesse können in Gruppen geclustert werden, z. B. in die bekannte Struktur von Kern-, Unterstützungs- und Führungsprozessen. Alternativ ist eine Gliederung in die Prozesse der internen Organisation, die benötigt werden, um die Funktionsfähigkeit der Organisation zu strukturieren, sowie die Prozesse, die sich an der Erfüllung der Bedürfnisse interessierter Parteien (Kunden, Behörden, Gesellschaft etc.) orientieren, möglich. Zwecks Übersichtlichkeit und Transparenz sollten die Prozesse in ihrem Zusammenhang in einer Grafik (z. B. Prozesslandschaft oder Prozessnetzwerk) dargestellt werden. Die Prozesse müssen den stattfindenden Veränderungen, die von innen oder von außen auf die Organisation einwirken, regelmäßig angepasst werden.
Die identifizierten Prozesse können in Gruppen geclustert werden, z. B. in die bekannte Struktur von Kern-, Unterstützungs- und Führungsprozessen. Alternativ ist eine Gliederung in die Prozesse der internen Organisation, die benötigt werden, um die Funktionsfähigkeit der Organisation zu strukturieren, sowie die Prozesse, die sich an der Erfüllung der Bedürfnisse interessierter Parteien (Kunden, Behörden, Gesellschaft etc.) orientieren, möglich. Zwecks Übersichtlichkeit und Transparenz sollten die Prozesse in ihrem Zusammenhang in einer Grafik (z. B. Prozesslandschaft oder Prozessnetzwerk) dargestellt werden. Die Prozesse müssen den stattfindenden Veränderungen, die von innen oder von außen auf die Organisation einwirken, regelmäßig angepasst werden.
4.4.3 Verantwortung für Prozesse
Bezug: IMS/4.4 und 9004/8.3
Um die Funktionsfähigkeit der Prozesse zu gewährleisten muss die Organisation die Rollen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die einzelnen Prozesse festlegen und in der Organisation bekannt machen. Sie hat für die benötigte Kompetenz der Prozessverantwortlichen zu sorgen, damit diese erstens die Funktionsfähigkeit der Prozesse aufrechterhalten können und zweitens damit die Prozesse stetig verbessert und Wechselwirkungsprobleme mit anderen Prozessen beseitigt werden.
Um die Funktionsfähigkeit der Prozesse zu gewährleisten muss die Organisation die Rollen, Befugnisse und Verantwortlichkeiten für die einzelnen Prozesse festlegen und in der Organisation bekannt machen. Sie hat für die benötigte Kompetenz der Prozessverantwortlichen zu sorgen, damit diese erstens die Funktionsfähigkeit der Prozesse aufrechterhalten können und zweitens damit die Prozesse stetig verbessert und Wechselwirkungsprobleme mit anderen Prozessen beseitigt werden.
4.4.4 Prozessmanagement
Bezug: IMS/4.4 und 9004/8.4
Prozesse sollten immer unter beherrschten Bedingungen stattfinden. Dazu ist es notwendig, dass sie einer fortlaufenden Lenkung unterliegen, die auch bei geplanten oder ungeplanten Veränderungen wirksam ist. Zur Lenkung der Prozesse sind, wo nötig oder normativ gefordert, die Prozesse zu dokumentieren und die Wirksamkeit der Prozesse ist durch dokumentierte Information nachzuweisen. Vorgaben wie Nachweise sind aktuell zu halten. Zum aktiven Prozessmanagement gehört auch,
Prozesse sollten immer unter beherrschten Bedingungen stattfinden. Dazu ist es notwendig, dass sie einer fortlaufenden Lenkung unterliegen, die auch bei geplanten oder ungeplanten Veränderungen wirksam ist. Zur Lenkung der Prozesse sind, wo nötig oder normativ gefordert, die Prozesse zu dokumentieren und die Wirksamkeit der Prozesse ist durch dokumentierte Information nachzuweisen. Vorgaben wie Nachweise sind aktuell zu halten. Zum aktiven Prozessmanagement gehört auch,
| • | die Verknüpfungen und Wechselwirkung der Prozesse zu lenken, |
| • | die Kriterien für die Prozesswirksamkeit festzulegen und zu überwachen sowie |
| • | die Risiken und Chancen der Prozesse zu erfassen, zu bewerten und ggf. Maßnahmen zu ergreifen. |
MS übergreifende Lenkung
Eine gemeinsame Lenkung der Prozesse ist dann einzurichten, wenn die spezifischen Managementsysteme gleichartige Anforderungen an das IMS stellen, um Mehrfacharbeit zu vermeiden. Bei Prozessen, die nur für ein spezifisches Managementsystem relevant sind und nur Forderungen an ein einzelnes Managementsystem stellen (z. B. Umweltaspekte), aber die mitgeltenden Schnittstellen zu anderen Prozessen haben (z. B. Dokumentierte Information), müssen die Schnittstellen einer stetigen Überwachung unterliegen. Dies ist z. B. bei Managementsystemen der Fall wie
Eine gemeinsame Lenkung der Prozesse ist dann einzurichten, wenn die spezifischen Managementsysteme gleichartige Anforderungen an das IMS stellen, um Mehrfacharbeit zu vermeiden. Bei Prozessen, die nur für ein spezifisches Managementsystem relevant sind und nur Forderungen an ein einzelnes Managementsystem stellen (z. B. Umweltaspekte), aber die mitgeltenden Schnittstellen zu anderen Prozessen haben (z. B. Dokumentierte Information), müssen die Schnittstellen einer stetigen Überwachung unterliegen. Dies ist z. B. bei Managementsystemen der Fall wie
| • | für Umwelt- und Energie (ISO 14001, ISO 50001), |
| • | für Gesundheit, Sicherheit, Schutz (ISO 45001, ISO/IEC 27001) und |
| • | für gesellschaftliche Verantwortung und Korruption (ISO 22301, ISO 22316). |
Leistungskriterien (KPI)
Alle Prozesse sollten durch die Organisation regelmäßig, hinsichtlich ihrer Anwendung und Ergebnisse, anhand von Leistungskriterien (KPI) überwacht werden, um Nichtkonformitäten und Leistungsschwächen rechtzeitig erkennen zu können. Dies schließt auch die Überwachung von Material, Equipment, Ressourcen, Kompetenz, geplanten und ungeplanten Veränderungen mit ein. Bei erkanntem Leistungsabfall sind Korrekturmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
Alle Prozesse sollten durch die Organisation regelmäßig, hinsichtlich ihrer Anwendung und Ergebnisse, anhand von Leistungskriterien (KPI) überwacht werden, um Nichtkonformitäten und Leistungsschwächen rechtzeitig erkennen zu können. Dies schließt auch die Überwachung von Material, Equipment, Ressourcen, Kompetenz, geplanten und ungeplanten Veränderungen mit ein. Bei erkanntem Leistungsabfall sind Korrekturmaßnahmen zu planen und durchzuführen.
Prozessqualität aufrecht erhalten
Die Aufrechterhaltung einer erreichten Prozessqualität kann im Sinne des Prozessmanagements nur ein erster Schritt sein. Gemäß dem Motto „Wer nicht gegen den Strom schwimmt fällt zurück!”, sollten die Prozessqualität und -wirksamkeit ständig verbessert werden, um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Dies sollte in Übereinstimmung mit der Politik, der Strategie und den Zielen der Organisation stattfinden. Um die nachhaltige Verbesserung der Prozesswirksamkeit zu erreichen, sollten operative Ziele zur Prozessverbesserung festgelegt werden. Dabei sind Veränderungen bei der Entwicklung von Wissen, Technologie, Methoden und Innovationen zu berücksichtigen. Auch die Personen in der Organisation sollten motiviert werden, sich an der stetigen Prozessverbesserung zum nachhaltigen Erfolg der Organisation zu beteiligen.
Die Aufrechterhaltung einer erreichten Prozessqualität kann im Sinne des Prozessmanagements nur ein erster Schritt sein. Gemäß dem Motto „Wer nicht gegen den Strom schwimmt fällt zurück!”, sollten die Prozessqualität und -wirksamkeit ständig verbessert werden, um ein höheres Leistungsniveau zu erreichen. Dies sollte in Übereinstimmung mit der Politik, der Strategie und den Zielen der Organisation stattfinden. Um die nachhaltige Verbesserung der Prozesswirksamkeit zu erreichen, sollten operative Ziele zur Prozessverbesserung festgelegt werden. Dabei sind Veränderungen bei der Entwicklung von Wissen, Technologie, Methoden und Innovationen zu berücksichtigen. Auch die Personen in der Organisation sollten motiviert werden, sich an der stetigen Prozessverbesserung zum nachhaltigen Erfolg der Organisation zu beteiligen.
Die Steigerung des Leistungsgrades der Prozesse ist in regelmäßigen Abständen z. B. durch interne Audits oder die Selbstbewertung des nachhaltigen Erfolgs zu überwachen und neu zu bewerten.
5.1 Führung und Verpflichtung
Bezug: IMS/5.1 und 9004/7.1
Die Führung des IMS liegt in der Verantwortung der obersten Leitung. Sie kann ein Teil der Ausführungsverantwortung an nachgeordnete Personen in der Organisation delegieren. Die Pflicht zur regelmäßigen Überwachung der Ausführung bleibt davon unberührt.
Die Führung des IMS liegt in der Verantwortung der obersten Leitung. Sie kann ein Teil der Ausführungsverantwortung an nachgeordnete Personen in der Organisation delegieren. Die Pflicht zur regelmäßigen Überwachung der Ausführung bleibt davon unberührt.
Verantwortung der obersten Leitung
Im Rahmen seiner Führungsverantwortung übernimmt die oberste Leitung
Im Rahmen seiner Führungsverantwortung übernimmt die oberste Leitung
| • | die Rechenschaftspflicht für die Wirksamkeit des IMS und die Erreichung des bestmöglichen Levels des nachhaltigen Erfolgs der Organisation; |
| • | die Verantwortung für die Schaffung einer Organisationskultur, die durch klare Vision und Werte eine IMS Politik formuliert, die Grundlage für die Strategie und Zieldefinition der Organisation ist und, wenn relevant, Nachhaltigkeitsaspekte dabei berücksichtigt; |
| • | die aktive Unterstützung der Führungskräfte, ihre Aufgaben zur Umsetzung und Weiterentwicklung des IMS zum Nutzen einer nachhaltigen Entwicklung der Organisation wahrzunehmen; |
| • | die Förderung einer Kultur gemeinsamer Werte wie Integrität, Fairness und Vertrauen in der Organisation; |
| • | die Verantwortung für eine ausreichende Ressourcenzuteilung an Mitteln, Personen und Kompetenz, die die Funktionsfähigkeit und die Wettbewerbsfähigkeit der Organisation verbessert; |
| • | die Förderung des Bewusstseins in der Organisation für die Bedeutung des IMS und seiner Prozesse hinsichtlich der Erfüllung der Organisationsziele und einer nachhaltigen Entwicklung; |
| • | die Aufgabe, dass der Kontext der Organisation und die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien in der Strategie der Organisation und den Regelungen des IMS berücksichtigt werden; |
| • | die Förderung des prozessorientierten und risikobasierenden Ansatzes im Bewusstsein der Organisation. |
5.2.1 Festlegen der Politik und Strategie
Bezug: IMS/5.2 und 9004/7.2
Die Führung ist verantwortlich für die Formulierung einer Organisationspolitik, die alle Aspekte des IMS und seiner spezifischen Normen abdeckt. Das sind z. B. Aspekte von Compliance, Qualität, Umwelt, Energie, Beschäftigung, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, darüber hinaus, soweit gewünscht, aber auch Themen der Nachhaltigkeit wie z. B. Qualität des Berufslebens, Innovation, Privatsphäre, Datenschutz, Erwartungen interessierter Parteien und ggf. weitere Aspekte.
Die Führung ist verantwortlich für die Formulierung einer Organisationspolitik, die alle Aspekte des IMS und seiner spezifischen Normen abdeckt. Das sind z. B. Aspekte von Compliance, Qualität, Umwelt, Energie, Beschäftigung, Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz, darüber hinaus, soweit gewünscht, aber auch Themen der Nachhaltigkeit wie z. B. Qualität des Berufslebens, Innovation, Privatsphäre, Datenschutz, Erwartungen interessierter Parteien und ggf. weitere Aspekte.
Politik
Die Politik bildet den Rahmen für die Festlegung von IMS-Zielen und umfasst, soweit relevant, Verpflichtungen zur Erfüllung der Anforderungen interessierter Parteien (z. B. Kunden, Behörden, Belegschaft) sowie zur fortlaufenden Verbesserung.
Die Politik bildet den Rahmen für die Festlegung von IMS-Zielen und umfasst, soweit relevant, Verpflichtungen zur Erfüllung der Anforderungen interessierter Parteien (z. B. Kunden, Behörden, Belegschaft) sowie zur fortlaufenden Verbesserung.
Strategie
Die Strategie dient der Weiterentwicklung der Identität der Organisation unter berücksichtigt des Kontexts und der langfristigen Perspektiven. Dazu gehören Entscheidungen zu Wettbewerbsfaktoren wie: Produkte/Dienstleistungen, Personen, Wissen und Technologie, Partner, Prozesse, Märkte, Preisgestaltung etc. Alle lang- und mittelfristigen Ziele sollten mit der Umsetzung der Strategie im Einklang sein.
Die Strategie dient der Weiterentwicklung der Identität der Organisation unter berücksichtigt des Kontexts und der langfristigen Perspektiven. Dazu gehören Entscheidungen zu Wettbewerbsfaktoren wie: Produkte/Dienstleistungen, Personen, Wissen und Technologie, Partner, Prozesse, Märkte, Preisgestaltung etc. Alle lang- und mittelfristigen Ziele sollten mit der Umsetzung der Strategie im Einklang sein.
Entscheidungen über Politik und Strategie sollten hinsichtlich möglicher Veränderungen der Rahmenbedingungen auf ihre weitere Eignung durch die oberste Leitung regelmäßig (ca. alle drei bis fünf Jahre) überprüft werden.
5.2.2 Bekanntmachung von Politik und Strategie
Bezug: IMS/5.2 und 9004/7.4
Die IMS-Politik muss als dokumentierte Information verfügbar sein. Sie muss in der Organisation bekanntgemacht, verstanden und angewendet werden. Art und Form der Umsetzung kann die Organisation nach Bedarf selbst festlegen. Die Politik muss auch interessierten Parteien zugänglich gemacht werden.
Die IMS-Politik muss als dokumentierte Information verfügbar sein. Sie muss in der Organisation bekanntgemacht, verstanden und angewendet werden. Art und Form der Umsetzung kann die Organisation nach Bedarf selbst festlegen. Die Politik muss auch interessierten Parteien zugänglich gemacht werden.
Auch die Strategie einer Organisation sollte schriftlich fixiert werden und zumindest dem Führungskreis der Organisation kommuniziert werden. Eine Veröffentlichung an interessierte Kreise könnte nur ggf. in Ausnahmen vorgesehen (z. B. Eigentümer oder Kreditgeber) sein.
Politik und Strategie bilden die Grundlage für die Ausrichtung des Prozessmanagements der Organisation.
5.3 Rollen, Verantwortlichkeit und Befugnisse
Bezug: IMS/5.3
Eine der wesentlichen Aufgaben der obersten Leitung sind das Festlegen der Hierarchie der Organisation und die damit verbundene Zuteilung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen an weitere Personen. Über die Zuteilung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen ist sicherzustellen, dass das IMS die relevanten normativen Anforderungen erfüllt, die Prozesse so gelenkt werden, dass sie unter beherrschten Bedingungen ablaufen, und dass eine Berichtsstruktur über die Wirksamkeit des IMS und seiner Prozesse an die oberste Leitung vorhanden ist und auch bei Änderungen am IMS bestehen bleibt. Außerdem sollen die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien innerhalb der Organisation durch die Führungskräfte bekannt gemacht werden. Über die Zuteilung von Rollen, Verantwortung und Befugnissen sind aktuelle dokumentierte Informationen zu führen.
Eine der wesentlichen Aufgaben der obersten Leitung sind das Festlegen der Hierarchie der Organisation und die damit verbundene Zuteilung von Rollen, Verantwortlichkeiten und Befugnissen an weitere Personen. Über die Zuteilung von Verantwortlichkeiten und Befugnissen ist sicherzustellen, dass das IMS die relevanten normativen Anforderungen erfüllt, die Prozesse so gelenkt werden, dass sie unter beherrschten Bedingungen ablaufen, und dass eine Berichtsstruktur über die Wirksamkeit des IMS und seiner Prozesse an die oberste Leitung vorhanden ist und auch bei Änderungen am IMS bestehen bleibt. Außerdem sollen die Anforderungen und Erwartungen interessierter Parteien innerhalb der Organisation durch die Führungskräfte bekannt gemacht werden. Über die Zuteilung von Rollen, Verantwortung und Befugnissen sind aktuelle dokumentierte Informationen zu führen.
5.4.1 Kundenorientierung
Bezug: 9001/5.1.2
Die oberste Leitung ist verantwortlich für die Kundeorientierung, damit Anforderungen der Kunden sowie gesetzliche/behördliche Anforderungen an das Produkt oder die Dienstleistung erfasst, verstanden und beständig erfüllt werden. Um dies zu gewährleisten, sind die Risiken und Chancen hinsichtlich der geforderten Konformität zu erfassen, zu bewerten und zu behandeln. Auch die Fähigkeit zur Erhöhung der Kundenzufrieden ist zu bestimmen und aufrechtzuerhalten.
Die oberste Leitung ist verantwortlich für die Kundeorientierung, damit Anforderungen der Kunden sowie gesetzliche/behördliche Anforderungen an das Produkt oder die Dienstleistung erfasst, verstanden und beständig erfüllt werden. Um dies zu gewährleisten, sind die Risiken und Chancen hinsichtlich der geforderten Konformität zu erfassen, zu bewerten und zu behandeln. Auch die Fähigkeit zur Erhöhung der Kundenzufrieden ist zu bestimmen und aufrechtzuerhalten.
5.4.2 Konsultation und Beteiligung der Beschäftigten
Bezug: 45001/5.4
In der Organisation sind Prozesse festzulegen zur Konsultation der Beschäftigten auf allen zutreffenden Ebenen und Funktionen hinsichtlich der Themen des SGA-Managements (SGA steht für: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit). Diese Prozesse sind einzuführen und aufrechtzuerhalten, sowie stetig zu verbessern. Wo vorhanden, sind Arbeitnehmervertreter in Entwicklung, Planung, Verwirklichung des SGA-Managements einzubinden.
In der Organisation sind Prozesse festzulegen zur Konsultation der Beschäftigten auf allen zutreffenden Ebenen und Funktionen hinsichtlich der Themen des SGA-Managements (SGA steht für: Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit). Diese Prozesse sind einzuführen und aufrechtzuerhalten, sowie stetig zu verbessern. Wo vorhanden, sind Arbeitnehmervertreter in Entwicklung, Planung, Verwirklichung des SGA-Managements einzubinden.
Wirksame Beteilung
Um eine wirksame Beteiligung der Mitarbeiter zu ermöglichen, sind
Um eine wirksame Beteiligung der Mitarbeiter zu ermöglichen, sind
| • | die notwendigen Ressourcen (z. B. Zeit, Schulung, Information) rechtzeitig zur Verfügung zu stellen, |
| • | Hindernisse bei der Beteiligung (z. B. Sprache, Geschlecht, Androhen von Repressalien) zu beseitigen oder so weit wie möglich zu minimieren. |
Zu bestimmten festgelegten Themen (Normkapitel 5.4, Aufzählung d) ist eine Konsultation (Unterrichtung) der Mitarbeiter vorzunehmen, die nicht der Leitungsebene angehören. Bei anderen definierten SGA-Themen (Normkapitel 5.4, Aufzählung e) ist eine Beteiligung von Mitarbeitern ohne Leitungsfunktion vorzusehen.
6.1 Umgang mit Risiken und Chancen
Bezug: IMS/6.1
Bei der Planung des IMS muss die Organisation die für den Kontext und die interessierten Parteien relevanten Risiken und Chancen erfassen, analysieren und bewerten. Aus der Bewertung sind Maßnahmen zum Umgang mit ihnen abzuleiten. Diese Maßnahmen sollten sicherstellen, dass geplante Ergebnisse erreicht werden und unerwünschte Auswirkungen (Risiken) auf geplante Ergebnisse des IMS nicht auftreten oder minimiert werden und dass erwünschte Auswirkungen (Chancen) verstärkt werden, um eine weitere Verbesserung zu erreichen.
Bei der Planung des IMS muss die Organisation die für den Kontext und die interessierten Parteien relevanten Risiken und Chancen erfassen, analysieren und bewerten. Aus der Bewertung sind Maßnahmen zum Umgang mit ihnen abzuleiten. Diese Maßnahmen sollten sicherstellen, dass geplante Ergebnisse erreicht werden und unerwünschte Auswirkungen (Risiken) auf geplante Ergebnisse des IMS nicht auftreten oder minimiert werden und dass erwünschte Auswirkungen (Chancen) verstärkt werden, um eine weitere Verbesserung zu erreichen.
Die geplanten Maßnahmen zum Umgang mit Risiken und Chancen müssen im Rahmen von IMS-Prozessen umgesetzt werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist soweit wie möglich zu bewerten.
6.2.1 Festlegen der Ziele
Bezug: IMS/6.2 und 9004/7.3
Die oberste Leitung soll im Rahmen ihrer Führungsverantwortung basierend auf der Politik und der Strategie der Organisation für das IMS Ziele festlegen. Die Ziele, kurz- wie langfristig, müssen für alle relevanten Funktionen, Ebenen und Prozesse festgelegt werden; dabei sollte die Führung die anderen Ebenen kommunikativ beteiligen. Die Ziele müssen, wo immer möglich quantifizierbar (messbar) sein und den Beteiligten vermittelt werden. Sie müssen die Konformität von Produkten/Dienstleistungen sowie die Mehrung der Zufriedenheit interessierter Kreise berücksichtigen. Zur Absicherung der Zielerreichung muss der Fortschritt der Ziele überwacht werden. Ggf. müssen Ziele auch veränderten Umständen angepasst werden. Zu den Zielen und den Maßnahmen, diese zu erreichen, sind dokumentierte Informationen zu führen.
Die oberste Leitung soll im Rahmen ihrer Führungsverantwortung basierend auf der Politik und der Strategie der Organisation für das IMS Ziele festlegen. Die Ziele, kurz- wie langfristig, müssen für alle relevanten Funktionen, Ebenen und Prozesse festgelegt werden; dabei sollte die Führung die anderen Ebenen kommunikativ beteiligen. Die Ziele müssen, wo immer möglich quantifizierbar (messbar) sein und den Beteiligten vermittelt werden. Sie müssen die Konformität von Produkten/Dienstleistungen sowie die Mehrung der Zufriedenheit interessierter Kreise berücksichtigen. Zur Absicherung der Zielerreichung muss der Fortschritt der Ziele überwacht werden. Ggf. müssen Ziele auch veränderten Umständen angepasst werden. Zu den Zielen und den Maßnahmen, diese zu erreichen, sind dokumentierte Informationen zu führen.
Mögliche Ziele können auch für die nicht normativen Themen zur Nachhaltigkeit formuliert werden. Mit ihnen sollte im Umgang genauso verfahren werden wie mit den anderen normativen Zielen.
6.2.2 Planung zur Zielerreichung
Bezug: IMS/6.2 und 9004/7.3
Bei der Planung zur Erreichung der IMS-Ziele muss die Organisation Fragen wie Ressourcenbedarf, Beteiligte, Verantwortung, Abschlusstermin und Ergebnisbewertung klären und Festlegungen dazu treffen.
Bei der Planung zur Erreichung der IMS-Ziele muss die Organisation Fragen wie Ressourcenbedarf, Beteiligte, Verantwortung, Abschlusstermin und Ergebnisbewertung klären und Festlegungen dazu treffen.
6.3 Bindende Verpflichtungen
Bezug: 9001–50001/4.2 und 14001–45001/6.1
Bindende Verpflichtungen müssen ermittelt und hinsichtlich ihrer Auswirkung und Bedeutung für die Organisation analysiert werden. Bindende Verpflichtungen können rechtlicher Natur sein (Gesetze, Genehmigungen, Zulassungen) oder freiwillig eingegangene Pflichten. Zu den bindenden Verpflichtungen sind dokumentierte Informationen zu erstellen und aufrechtzuerhalten.
Bindende Verpflichtungen müssen ermittelt und hinsichtlich ihrer Auswirkung und Bedeutung für die Organisation analysiert werden. Bindende Verpflichtungen können rechtlicher Natur sein (Gesetze, Genehmigungen, Zulassungen) oder freiwillig eingegangene Pflichten. Zu den bindenden Verpflichtungen sind dokumentierte Informationen zu erstellen und aufrechtzuerhalten.
Für die Einhaltung der bindenden Verpflichtungen sind, wenn notwendig, Verantwortlichkeiten seitens der obersten Leitung festzulegen.
Die bindenden Verpflichtungen für die spezifischen Managementsysteme des IMS können Risiken und Chancen enthalten, die gemäß den Festlegungen von 6.1 zu behandeln sind.
6.4.1 Planung von Änderungen
Bezug: 9001/6.3
Notwendige Änderungen am QM-System müssen in geplanter Weise durchgeführt werden. Dabei müssen Fragen wie Konsequenzen für das QMS und seine Integrität, die Verfügbarkeit von Ressourcen zur Durchführung der Änderung und die ggf. vorzunehmenden Änderungen von Verantwortlichkeiten und Befugnissen berücksichtigt werden.
Notwendige Änderungen am QM-System müssen in geplanter Weise durchgeführt werden. Dabei müssen Fragen wie Konsequenzen für das QMS und seine Integrität, die Verfügbarkeit von Ressourcen zur Durchführung der Änderung und die ggf. vorzunehmenden Änderungen von Verantwortlichkeiten und Befugnissen berücksichtigt werden.
6.4.2 Umweltaspekte
Bezug: 14001/6.1.2
Im Rahmen des anwendbaren Geltungsbereichs muss die Organisation die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen bestimmen, wenn sie darauf Einfluss nehmen kann. Dazu gehören auch die Umweltauswirkungen, die durch die spätere Nutzung (Lebensweg) entstehen. Bei der Erfassung der Umweltaspekte sind nicht nur der Regelfall, sondern auch Notfälle und nicht bestimmungsgemäße Zustände zu berücksichtigen, inklusive geplanter oder neuer Entwicklungen bei Produkten und Tätigkeiten.
Im Rahmen des anwendbaren Geltungsbereichs muss die Organisation die Umweltaspekte ihrer Tätigkeiten, Produkte und Dienstleistungen bestimmen, wenn sie darauf Einfluss nehmen kann. Dazu gehören auch die Umweltauswirkungen, die durch die spätere Nutzung (Lebensweg) entstehen. Bei der Erfassung der Umweltaspekte sind nicht nur der Regelfall, sondern auch Notfälle und nicht bestimmungsgemäße Zustände zu berücksichtigen, inklusive geplanter oder neuer Entwicklungen bei Produkten und Tätigkeiten.
Bedeutende Umweltaspekte
Die Umweltaspekte sind nach festgelegten Kriterien hinsichtlich ihrer Bedeutung zu bewerten, um die wesentlichen Aspekte zu identifizieren. Die so bestimmten bedeutenden Umweltaspekte sind in der Organisation zu kommunizieren. Zu ihnen und den damit verbundenen Umweltauswirkungen müssen dokumentierte Informationen erstellt werden. Ebenso zu dokumentieren sind die verwendeten Bestimmungs- und Bewertungskriterien. Bedeutende Umweltaspekte sollen bevorzugt eine Grundlage für Umweltziele bilden, um deren Auswirkungen zu verringern.
Die Umweltaspekte sind nach festgelegten Kriterien hinsichtlich ihrer Bedeutung zu bewerten, um die wesentlichen Aspekte zu identifizieren. Die so bestimmten bedeutenden Umweltaspekte sind in der Organisation zu kommunizieren. Zu ihnen und den damit verbundenen Umweltauswirkungen müssen dokumentierte Informationen erstellt werden. Ebenso zu dokumentieren sind die verwendeten Bestimmungs- und Bewertungskriterien. Bedeutende Umweltaspekte sollen bevorzugt eine Grundlage für Umweltziele bilden, um deren Auswirkungen zu verringern.
6.4.3 Ermittlung und Bewertung von Gefährdung
Bezug: 45001/6.1.2
Die Organisation ist verpflichtet die Gefährdungen für die Gesundheit, die von der Arbeit ausgehen können fortlaufend zu ermitteln und zu bewerten (Risiken und Chancen). Dazu sind entsprechende Prozesse einzurichten und aufrechtzuerhalten. In den Prozessen müssen Regelungen enthalten sein zur
Die Organisation ist verpflichtet die Gefährdungen für die Gesundheit, die von der Arbeit ausgehen können fortlaufend zu ermitteln und zu bewerten (Risiken und Chancen). Dazu sind entsprechende Prozesse einzurichten und aufrechtzuerhalten. In den Prozessen müssen Regelungen enthalten sein zur
| • | Arbeitsorganisation (inkl. sozialer Faktoren), |
| • | Arbeitsplatzgestaltung und |
| • | Arbeitsausführung. |
Zusätzlich sind zu berücksichtigen: potenzielle Notfallsituationen, menschliche Faktoren, Funktion von Personen und andere Themen, die die Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz betreffen.
Risiken
Die mit methodischen Verfahren ermittelten Gefährdungen sind hinsichtlich ihres Ausmaßes systematisch zu bewerten und entsprechend der Risikohöhe geeignete Vorsorge- und Sicherungsmaßnahmen zu definieren. Dabei sollten die Maßnahmen mehr proaktiv als reaktiv sein.
Die mit methodischen Verfahren ermittelten Gefährdungen sind hinsichtlich ihres Ausmaßes systematisch zu bewerten und entsprechend der Risikohöhe geeignete Vorsorge- und Sicherungsmaßnahmen zu definieren. Dabei sollten die Maßnahmen mehr proaktiv als reaktiv sein.
Chancen
Neben der Ermittlung von Risiken sollte auch eine Betrachtung der Chancen zur Verbesserung der SGA-Leistung regelmäßig erfolgen. Das umfasst sowohl Chancen zur Anpassung der Arbeit an den Menschen als auch Chancen zur Beseitigung von potenziellen Gefahrenquellen.
Neben der Ermittlung von Risiken sollte auch eine Betrachtung der Chancen zur Verbesserung der SGA-Leistung regelmäßig erfolgen. Das umfasst sowohl Chancen zur Anpassung der Arbeit an den Menschen als auch Chancen zur Beseitigung von potenziellen Gefahrenquellen.
Über Methodik und Kriterien zur Ermittlung und Bewertung von Gefährdungen (Risiko und Chancen) sowie deren Folgemaßnahmen sind dokumentierte Informationen aufrechtzuerhalten.
6.4.4 Planung von Maßnahmen im SGA
Bezug: 45001/6.1.3
Um dem Umgang mit Risiken und Chancen, rechtlichen Verpflichtungen im SGA und zur Vorbereitung und zum Umgang mit Notfällen jederzeit gerecht werden zu können, müssen entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Folgen geplant werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist zu bewerten. Dabei sind eingeführte Methoden, technologische Möglichkeiten sowie betriebliche und geschäftliche Anforderungen zu berücksichtigen. Bei der Planung der Maßnahmen ist die Maßnahmenhierarchie (TOP-Prinzip) zu berücksichtigen – d. h. technische Lösungen vor organisatorischen Maßnahmen vor persönlicher Schutzausrüstung.
Um dem Umgang mit Risiken und Chancen, rechtlichen Verpflichtungen im SGA und zur Vorbereitung und zum Umgang mit Notfällen jederzeit gerecht werden zu können, müssen entsprechende Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung der Folgen geplant werden. Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist zu bewerten. Dabei sind eingeführte Methoden, technologische Möglichkeiten sowie betriebliche und geschäftliche Anforderungen zu berücksichtigen. Bei der Planung der Maßnahmen ist die Maßnahmenhierarchie (TOP-Prinzip) zu berücksichtigen – d. h. technische Lösungen vor organisatorischen Maßnahmen vor persönlicher Schutzausrüstung.
6.4.5 Energetische Bewertung
Bezug: 50001/6.3
Für das Energiemanagement (EnMS) muss eine energetische Bewertung durchgeführt werden, die den Energieeinsatz der Organisation ermittelt und hinsichtlich der Größe bewertet. Dazu sind zuerst die eingesetzten Energieträger und deren Menge zu erfassen (z. B. über Rechnungen). Zur Erfassung der Verbräuche einzelner Verbraucher (z. B. Maschinen, Beleuchtung) werden Messwerte, Berechnungen oder andere Ermittlungsmethoden herangezogen. Aus Vergleichsgründen sollten auch Werte aus der nahen Vergangenheit (z. B. Vorjahr) ermittelt werden.
Für das Energiemanagement (EnMS) muss eine energetische Bewertung durchgeführt werden, die den Energieeinsatz der Organisation ermittelt und hinsichtlich der Größe bewertet. Dazu sind zuerst die eingesetzten Energieträger und deren Menge zu erfassen (z. B. über Rechnungen). Zur Erfassung der Verbräuche einzelner Verbraucher (z. B. Maschinen, Beleuchtung) werden Messwerte, Berechnungen oder andere Ermittlungsmethoden herangezogen. Aus Vergleichsgründen sollten auch Werte aus der nahen Vergangenheit (z. B. Vorjahr) ermittelt werden.
significant energy use
Aufgrund der Analyse sind die Bereiche mit wesentlichem Energieeinsatz – significant energy use (SEU) – zu ermitteln. Dies kann eine maschinelle Anlage sein oder ein Bereich mit mehreren Verbrauchern. Für jeden SEU ist der aktuelle Verbrauch aller relevanten Energieträger zu bestimmen – außerdem die auf den Verbrauch einwirkenden Variablen und der Einfluss von Personen.
Aufgrund der Analyse sind die Bereiche mit wesentlichem Energieeinsatz – significant energy use (SEU) – zu ermitteln. Dies kann eine maschinelle Anlage sein oder ein Bereich mit mehreren Verbrauchern. Für jeden SEU ist der aktuelle Verbrauch aller relevanten Energieträger zu bestimmen – außerdem die auf den Verbrauch einwirkenden Variablen und der Einfluss von Personen.
Zur Verbesserung der energiebezogenen Leistung sind Potenziale für Energieeffizienzmaßnamen und deren Größenordnung zu ermitteln. Bei größeren Änderungen der Inhalte und in festgelegten Zeitabständen (z. B. ein Jahr) ist diese Bewertung zu aktualisieren.
Die Kriterien für die energetische Bewertung und deren Ergebnisse sind als dokumentierte Information zu erfassen und aufzubewahren.
6.4.6 Energieleistungskennzahlen
Bezug: 50001/6.4
Für das EnMS müssen Energieleistungskennzahlen (EnPI) bestimmt werden, die für die Messung und Überwachung der energiebezogenen Leistung und zu deren Verbesserung geeignet sind. Wenn variable Größen sich auf die energiebezogene Leistung auswirken, sind diese bei der Bewertung der EnPI zu berücksichtigen.
Für das EnMS müssen Energieleistungskennzahlen (EnPI) bestimmt werden, die für die Messung und Überwachung der energiebezogenen Leistung und zu deren Verbesserung geeignet sind. Wenn variable Größen sich auf die energiebezogene Leistung auswirken, sind diese bei der Bewertung der EnPI zu berücksichtigen.
Die Art und Weise der Bestimmung der EnPI ist als dokumentierte Information zu führen. Die ermittelten Kennzahlen sind in geeigneter Weise mit den Ist-Werten zu vergleichen, um daraus Schlüsse für die Energieeffizienz zu ziehen. Die EnPI-Werte sind zu dokumentieren und, soweit nötig, aufzubewahren.
6.4.7 Energetische Ausgangsbasis
Bezug: 50001/6.5
Auf der Grundlage der energetischen Bewertung muss die Organisation eine energetische Ausgangsbasis bestimmen, anhand deren sie den Fortschritt von Energieeffizienzmaßnahmen für einen angemessenen Zeitraum bestimmen kann. Sollten Variablen sich wesentlich auf die energiebezogene Leistung auswirken, soll über eine Normalisierung die Vergleichbarkeit der EnPIs erreicht werden. Die energetische Ausgangsbasis muss aktualisiert werden, wenn sie nicht mehr die energiebezogene Leistung der Organisation widerspiegelt oder deutliche Veränderungen in den statistischen Faktoren eingetreten sind. Informationen zur energetischen Ausgangsbasis und ihren Veränderungen sind als dokumentierte Information aufzubewahren.
Auf der Grundlage der energetischen Bewertung muss die Organisation eine energetische Ausgangsbasis bestimmen, anhand deren sie den Fortschritt von Energieeffizienzmaßnahmen für einen angemessenen Zeitraum bestimmen kann. Sollten Variablen sich wesentlich auf die energiebezogene Leistung auswirken, soll über eine Normalisierung die Vergleichbarkeit der EnPIs erreicht werden. Die energetische Ausgangsbasis muss aktualisiert werden, wenn sie nicht mehr die energiebezogene Leistung der Organisation widerspiegelt oder deutliche Veränderungen in den statistischen Faktoren eingetreten sind. Informationen zur energetischen Ausgangsbasis und ihren Veränderungen sind als dokumentierte Information aufzubewahren.
6.4.8 Planung zur energiebezogenen Datensammlung
Bezug: 50001/6.6
Im Vorfeld der Messung und Überwachung der energiebezogenen Leistung ist eine Planung der Energiedatensammlung durchzuführen. Dabei sind die Ressourcen zur Messung und Überwachung (z. B. Messstellen, Auswerteequipment) angemessen zu berücksichtigen. Art und Häufigkeit der Datenerfassung und -analyse sind festzulegen, insbesondere für die Überwachung der Hauptmerkmale.
Im Vorfeld der Messung und Überwachung der energiebezogenen Leistung ist eine Planung der Energiedatensammlung durchzuführen. Dabei sind die Ressourcen zur Messung und Überwachung (z. B. Messstellen, Auswerteequipment) angemessen zu berücksichtigen. Art und Häufigkeit der Datenerfassung und -analyse sind festzulegen, insbesondere für die Überwachung der Hauptmerkmale.
Datenerfassung
Bei der Datenerfassung sind zu berücksichtigen:
Bei der Datenerfassung sind zu berücksichtigen:
| • | relevante Variablen und statistischen Faktoren bezüglich der SEUs und |
| • | betrieblichen Kriterien und ihr Einfluss auf Energieverbrauch der SEUs. |
Datensammelplan
Die dokumentierten Informationen zur Energiedatensammlung (Datensammelplan) müssen in festgelegten Zeitabständen (z. B. einmal im Jahr) und bei wesentlichen betrieblichen Veränderungen aktualisiert werden. Dazu ist die Vorgehensweise, soweit angemessen, als dokumentierte Information zu erstellen.
Die dokumentierten Informationen zur Energiedatensammlung (Datensammelplan) müssen in festgelegten Zeitabständen (z. B. einmal im Jahr) und bei wesentlichen betrieblichen Veränderungen aktualisiert werden. Dazu ist die Vorgehensweise, soweit angemessen, als dokumentierte Information zu erstellen.
Messmittel
Die zur Messung der Hauptmerkmale verwendete Ausrüstung (Messmittel) muss geeignet sein, jederzeit genaue und reproduzierbare Messwerte zu liefern. Diese Fähigkeit ist in festgelegten Zeiträumen zu überprüfen. Die Ergebnisse der Überprüfung sind zu dokumentieren und aufzubewahren.
Die zur Messung der Hauptmerkmale verwendete Ausrüstung (Messmittel) muss geeignet sein, jederzeit genaue und reproduzierbare Messwerte zu liefern. Diese Fähigkeit ist in festgelegten Zeiträumen zu überprüfen. Die Ergebnisse der Überprüfung sind zu dokumentieren und aufzubewahren.
7.1.1 Allgemeines
Bezug: IMS/7.1 und 9004/9.1
Ressourcen sind für die Verwirklichung des IMS, seiner Ziele, die Umsetzung der Prozesse sowie das Erreichen des nachhaltigen Erfolgs unabdingbar. Die internen wie externen Ressourcen, die benötigt werden, sind von der Organisation zu bestimmen. Das können z. B. sein: Finanzmittel, Personal, Wissen der Organisation, Technologie, Infrastruktur, Material oder Informationen. Durch eine wirksame Steuerung der Prozesse ist der effiziente Ressourceneinsatz zu gewährleisten.
Ressourcen sind für die Verwirklichung des IMS, seiner Ziele, die Umsetzung der Prozesse sowie das Erreichen des nachhaltigen Erfolgs unabdingbar. Die internen wie externen Ressourcen, die benötigt werden, sind von der Organisation zu bestimmen. Das können z. B. sein: Finanzmittel, Personal, Wissen der Organisation, Technologie, Infrastruktur, Material oder Informationen. Durch eine wirksame Steuerung der Prozesse ist der effiziente Ressourceneinsatz zu gewährleisten.
Die Organisation sollte den Ressourceneinsatz hinsichtlich seiner Chancen und Risiken sowie der Effizienz regelmäßig bewerten. Beim Einsatz neuer Ressourcen sind die Chancen und Risiken hinsichtlich ihrer Auswirkung auf den nachhaltigen Erfolg der Organisation zu berücksichtigen.
7.1.2 Natürliche Ressourcen
Bezug: 9004/9.7
Jede Organisation trägt auch gesellschaftliche Verantwortung für die Umwelt und den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Der Verbrauch von wichtigen Ressourcen wie Wasser, Boden, fossilen Energieträgern und Rohstoffen sollte ein strategisches Thema im Hinblick auf den nachhaltigen Erfolg der Organisation sein. Die aktuelle und zukünftige Nutzung von natürlichen Ressourcen sollte im Kontext des Lebenszyklus der erzeugten Produkte und Dienstleistungen betrachtet werden und dem Gebot der Minimierung folgen.
Jede Organisation trägt auch gesellschaftliche Verantwortung für die Umwelt und den schonenden Umgang mit natürlichen Ressourcen. Der Verbrauch von wichtigen Ressourcen wie Wasser, Boden, fossilen Energieträgern und Rohstoffen sollte ein strategisches Thema im Hinblick auf den nachhaltigen Erfolg der Organisation sein. Die aktuelle und zukünftige Nutzung von natürlichen Ressourcen sollte im Kontext des Lebenszyklus der erzeugten Produkte und Dienstleistungen betrachtet werden und dem Gebot der Minimierung folgen.
Nachhaltiges Wirtschaften
Dazu gehört eine Sensibilität für neue Trends und Technologien sowie die damit verbundenen Erwartungen interessierter Parteien. Der Entscheidung für zukünftige Märkte und Produkte im Hinblick auf den Lebenszyklus derselben und seine Auswirkungen auf den natürlichen Lebensraum des Menschen sollte eine Risiko-Chancen-Abwägung vorausgehen. Da sich der Verbrauch von Ressourcen zur Erzeugung von Produkten und Dienstleistungen nicht vollständig vermeiden lässt, sind die Nutzung bestverfügbarer Technologie in den Organisationsprozessen und die beste Nutzungspraxis im Lebenszyklus eine Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften.
Dazu gehört eine Sensibilität für neue Trends und Technologien sowie die damit verbundenen Erwartungen interessierter Parteien. Der Entscheidung für zukünftige Märkte und Produkte im Hinblick auf den Lebenszyklus derselben und seine Auswirkungen auf den natürlichen Lebensraum des Menschen sollte eine Risiko-Chancen-Abwägung vorausgehen. Da sich der Verbrauch von Ressourcen zur Erzeugung von Produkten und Dienstleistungen nicht vollständig vermeiden lässt, sind die Nutzung bestverfügbarer Technologie in den Organisationsprozessen und die beste Nutzungspraxis im Lebenszyklus eine Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaften.
7.1.3 Technologie
Bezug: 9004/9.4
Bestverfügbare Technik, Methoden und Know-how sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Organisation. Daher sollte die oberste Leitung bestehende und aufkommende technologische Entwicklungen, die Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Organisation haben können, regelmäßig beobachten. Die Organisation sollte über Prozesse und Methoden zum frühzeitigen Erkennen solcher Entwicklung verfügen. Im Marktumfeld sind Risiken und Chancen solcher Entwicklungen zu erfassen und unter Berücksichtigung des finanziellen Bedarfs an Investitionen und Mitteln zu bewerten.
Bestverfügbare Technik, Methoden und Know-how sind ein wesentlicher Faktor für den Erfolg der Organisation. Daher sollte die oberste Leitung bestehende und aufkommende technologische Entwicklungen, die Auswirkung auf die Leistungsfähigkeit der Organisation haben können, regelmäßig beobachten. Die Organisation sollte über Prozesse und Methoden zum frühzeitigen Erkennen solcher Entwicklung verfügen. Im Marktumfeld sind Risiken und Chancen solcher Entwicklungen zu erfassen und unter Berücksichtigung des finanziellen Bedarfs an Investitionen und Mitteln zu bewerten.
7.2 Kompetenz und Befähigung
Bezug: IMS/7.2 und 9004/9.2.4
Die Forderungen zur Kompetenz im IMS beziehen sich auf die Pflicht der Organisation die Kompetenz der Personen, die für die Organisation tätig sind (interne wie externe Personen), zu bestimmen und sicherstellen, dass diese den Kompetenzanforderungen genügen. Dies kann geschehen über Qualifikation, Training und andere geeignete Maßnahmen. Dokumentierte Information zur Kompetenzermittlung und zum Kompetenzerwerb sind zu führen und aufrechtzuerhalten.
Die Forderungen zur Kompetenz im IMS beziehen sich auf die Pflicht der Organisation die Kompetenz der Personen, die für die Organisation tätig sind (interne wie externe Personen), zu bestimmen und sicherstellen, dass diese den Kompetenzanforderungen genügen. Dies kann geschehen über Qualifikation, Training und andere geeignete Maßnahmen. Dokumentierte Information zur Kompetenzermittlung und zum Kompetenzerwerb sind zu führen und aufrechtzuerhalten.
Kompetenzentwicklungsmaßnahmen
Dazu sollten Prozesse eingerichtet werden, die Regelungen zur Kompetenz hinsichtlich Bestimmung, Entwicklung, Beurteilung und Verbesserung umfassen – wobei der Fokus nicht nur auf die gegenwärtigen Anforderungen an Kompetenz gerichtet sein darf, sondern, soweit bekannt, auch die zukünftigen Anforderungen einschließen sollte. Die Wirksamkeit der Kompetenzentwicklungsmaßnahmen ist zu bewerten und zu dokumentieren.
Dazu sollten Prozesse eingerichtet werden, die Regelungen zur Kompetenz hinsichtlich Bestimmung, Entwicklung, Beurteilung und Verbesserung umfassen – wobei der Fokus nicht nur auf die gegenwärtigen Anforderungen an Kompetenz gerichtet sein darf, sondern, soweit bekannt, auch die zukünftigen Anforderungen einschließen sollte. Die Wirksamkeit der Kompetenzentwicklungsmaßnahmen ist zu bewerten und zu dokumentieren.
7.3 Bewusstsein und Motivation
Bezug: IMS/7.3 und 9004/9.2.2–9.2.3
Unternehmen, die über engagierte Mitarbeiter verfügen, verbessern die Fähigkeit der Organisation, Werte für das Unternehmen und für interessierte Parteien zu schaffen. Führungskräfte auf allen Ebenen haben die Aufgabe, die Mitarbeiter entsprechend zu ermutigen. Dazu können die unterschiedlichsten Methoden und Werkzeuge genutzt werden, wie z. B.: Wissensmanagement, Zufriedenheitsermittlung, Kompetenzentwicklung, Teamarbeit.
Unternehmen, die über engagierte Mitarbeiter verfügen, verbessern die Fähigkeit der Organisation, Werte für das Unternehmen und für interessierte Parteien zu schaffen. Führungskräfte auf allen Ebenen haben die Aufgabe, die Mitarbeiter entsprechend zu ermutigen. Dazu können die unterschiedlichsten Methoden und Werkzeuge genutzt werden, wie z. B.: Wissensmanagement, Zufriedenheitsermittlung, Kompetenzentwicklung, Teamarbeit.
Anreizsysteme
Befähigung und Motivation von Personen haben das Ziel, das notwendige Bewusstsein zu schaffen, um sich mit Engagement für die Werte, die Strategie und Ziele der Organisation uneingeschränkt einzusetzen. Dazu können neben Information und Kompetenzentwicklung auch Anreizsysteme monetärer Art (z. B. Einzel- oder Teamprämien) oder nicht monetärer Art (z. B. Auszeichnungen) eingesetzt werden. Daneben sind auch Arbeitssysteme möglich, die die eigene Verantwortung durch das Schaffen von Ermessensspielräumen fördern.
Befähigung und Motivation von Personen haben das Ziel, das notwendige Bewusstsein zu schaffen, um sich mit Engagement für die Werte, die Strategie und Ziele der Organisation uneingeschränkt einzusetzen. Dazu können neben Information und Kompetenzentwicklung auch Anreizsysteme monetärer Art (z. B. Einzel- oder Teamprämien) oder nicht monetärer Art (z. B. Auszeichnungen) eingesetzt werden. Daneben sind auch Arbeitssysteme möglich, die die eigene Verantwortung durch das Schaffen von Ermessensspielräumen fördern.
Im Sinne des IMS muss sichergestellt werden, dass Personen, die für die Organisation tätig sind, Kenntnis von der IMS-Politik und den IMS-Zielen sowie ihrem Beitrag zur Wirksamkeit des IMS haben und wissen, welche Folgen eine Nichterfüllung von Festlegungen für das IMS haben kann.
7.4 Interne und externe Kommunikation
Bezug: IMS/7.4 und 9004/7.4
Eine wirksame Kommunikation von Politik und Strategie einschließlich der relevanten Ziele nach innen wie nach außen kann den nachhaltigen Erfolg der Organisation wesentlich unterstützen, wobei die Art der Medien und Inhalte der Kommunikation den unterschiedlichen Bedürfnissen der interessierten Kreise angepasst sein sollte.
Eine wirksame Kommunikation von Politik und Strategie einschließlich der relevanten Ziele nach innen wie nach außen kann den nachhaltigen Erfolg der Organisation wesentlich unterstützen, wobei die Art der Medien und Inhalte der Kommunikation den unterschiedlichen Bedürfnissen der interessierten Kreise angepasst sein sollte.
Der Kommunikationsprozess innerhalb der Organisation sollte gleichermaßen vertikal und horizontal organisiert sein und einen Rückmeldeprozess umfassen. Die externe Kommunikation gegenüber regelsetzenden oder regelüberwachenden interessierten Kreisen (Gesetzgeber, Behörden etc.) sollte im Hinblick auf Risiken für die Organisation und die oberste Leitung auf dokumentierter Grundlage erfolgen.
Für das IMS muss die interne sowie externe Kommunikation festgelegt werden bezüglich der zu kommunizierenden Inhalte, des Zeitpunkts und der Art der Kommunikation sowie der daran beteiligten Personen und/oder Organisationen.
7.5 Dokumentierte Information
Bezug: IMS/7.5
Die dokumentierte Information der Organisation umfasst die von den spezifischen Normen des IMS geforderte und von der Organisation benötigte dokumentierte Information, um die Organisationsprozesse unter beherrschten Bedingungen ablaufen zu lassen. Dazu gehören dokumentierte Vorgaben zur Erbringung der Leistung wie auch Nachweise über die erbrachte Leistung. Das schließt die dokumentierte Information zur Erreichung des nachhaltigen Erfolgs mit ein.
Die dokumentierte Information der Organisation umfasst die von den spezifischen Normen des IMS geforderte und von der Organisation benötigte dokumentierte Information, um die Organisationsprozesse unter beherrschten Bedingungen ablaufen zu lassen. Dazu gehören dokumentierte Vorgaben zur Erbringung der Leistung wie auch Nachweise über die erbrachte Leistung. Das schließt die dokumentierte Information zur Erreichung des nachhaltigen Erfolgs mit ein.
Der Umgang mit dokumentierter Information umfasst zwei Regelungsaspekte:
| • | das Erstellen und Aktualisieren der dokumentierten Information, |
| • | das Lenken von dokumentierter Information. |
Erstellen und Aktualisieren
Im Rahmen der Erstellung und Aktualisierung von dokumentierter Information muss die Organisation Kennzeichnung und Beschreibung sowie das Format festlegen. Vor der Nutzung müssen eine angemessene Überprüfung und eine Genehmigung hinsichtlich Eignung und Angemessenheit erfolgen.
Im Rahmen der Erstellung und Aktualisierung von dokumentierter Information muss die Organisation Kennzeichnung und Beschreibung sowie das Format festlegen. Vor der Nutzung müssen eine angemessene Überprüfung und eine Genehmigung hinsichtlich Eignung und Angemessenheit erfolgen.
Lenken
Die Lenkung der dokumentierten Information umfasst Punkte wie die Verteilung und Gewährleistung des autorisierten Zugriffs sowie die Ablage und Speicherung für den Zugriff. Auch die Überwachung von Änderungen ist ein Teil der Lenkung. Des Weiteren gehören die Archivierung und Regelungen zur Vernichtung der dokumentieren Information dazu. Nachweisdokumente zur Bestätigung der Konformität sind vor nachträglichen Änderungen zu schützen.
Die Lenkung der dokumentierten Information umfasst Punkte wie die Verteilung und Gewährleistung des autorisierten Zugriffs sowie die Ablage und Speicherung für den Zugriff. Auch die Überwachung von Änderungen ist ein Teil der Lenkung. Des Weiteren gehören die Archivierung und Regelungen zur Vernichtung der dokumentieren Information dazu. Nachweisdokumente zur Bestätigung der Konformität sind vor nachträglichen Änderungen zu schützen.
Von der Organisation benötigte externe dokumentierte Information müssen als solche gekennzeichnet, aktuell gehalten und gelenkt werden.
7.6.1 Personen
Bezug: 9001/7.1.2 und 9004/9.2.1
Die Organisation muss die notwendigen Personen bereitstellen, die sie benötigt, um das IMS und seine Prozesse unter beherrschten Bedingungen realisieren zu können. Dazu gehört befähigtes und motiviertes Personal in ausreichender Zahl. Die Organisation sollte über Prozesse zur Anwerbung, Bindung und Freisetzung von Personal verfügen.
Die Organisation muss die notwendigen Personen bereitstellen, die sie benötigt, um das IMS und seine Prozesse unter beherrschten Bedingungen realisieren zu können. Dazu gehört befähigtes und motiviertes Personal in ausreichender Zahl. Die Organisation sollte über Prozesse zur Anwerbung, Bindung und Freisetzung von Personal verfügen.
7.6.2 Infrastruktur
Bezug: 9001/7.1.3 und 9004/9.5.2
Die Organisation muss die notwendige Infrastruktur bereitstellen, die sie benötigt, um das IMS und seine Prozesse unter beherrschten Bedingungen realisieren zu können. Dazu können gehören Gebäude und Versorgungseinrichtungen, weitere Ausrüstung jedweder Art, Transport- und Kommunikationseinrichtungen sowie systemspezifische Infrastruktur gemäß den Forderungen der Einzelsysteme des IMS.
Die Organisation muss die notwendige Infrastruktur bereitstellen, die sie benötigt, um das IMS und seine Prozesse unter beherrschten Bedingungen realisieren zu können. Dazu können gehören Gebäude und Versorgungseinrichtungen, weitere Ausrüstung jedweder Art, Transport- und Kommunikationseinrichtungen sowie systemspezifische Infrastruktur gemäß den Forderungen der Einzelsysteme des IMS.
Weitere Anforderungen an die Infrastruktur sind eine ausreichende Verfügbarkeit und Instandhaltung sowie die benötigte Quantität und Qualität von Ausrüstung.
7.6.3 Prozess-(Arbeits)umgebung
Bezug: 9001/7.1.4 und 9004/9.5.3
Den Personen, die für die Organisation arbeiten, ist eine Arbeitsumgebung bereitzustellen, in der sie ihrer Tätigkeit nachgehen können, ohne Gefährdungen ihrer Gesundheit ausgesetzt zu sein oder in der qualitätsmindernde Einflüsse für ihre Tätigkeit zu befürchten sind. Bei der Bereitstellung der Arbeitsumgebung hat die Organisation soziale, psychologische und physikalische Faktoren zu berücksichtigen. Der Vermeidung und Vorbeugung von Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz ist dabei höchste Priorität einzuräumen.
Den Personen, die für die Organisation arbeiten, ist eine Arbeitsumgebung bereitzustellen, in der sie ihrer Tätigkeit nachgehen können, ohne Gefährdungen ihrer Gesundheit ausgesetzt zu sein oder in der qualitätsmindernde Einflüsse für ihre Tätigkeit zu befürchten sind. Bei der Bereitstellung der Arbeitsumgebung hat die Organisation soziale, psychologische und physikalische Faktoren zu berücksichtigen. Der Vermeidung und Vorbeugung von Gefahren und Belastungen am Arbeitsplatz ist dabei höchste Priorität einzuräumen.
Eine der Voraussetzungen für den nachhaltigen Erfolg einer Organisation ist die Bereitstellung einer Arbeitsumgebung, die die Produktivität, die Kreativität und das Wohlbefinden von Personen fördert.
7.6.4 Ressourcen zur Überwachung und Messung
Bezug: 9001/7.1.5, 50001/6.6, 14001 und 45001/9.1.1
Korrekte und zuverlässige Überwachungs- und Messergebnisse sind eine wesentliche Vorrausetzung für beherrschte Prozesse und die Einhaltung von Grenzwertvorgaben von Kunden und regelsetzenden Stellen (z. B. Behörden). Die Organisation muss daher sicherstellen, dass Ressourcen zur Überwachung und Messung geeignet sind,
Korrekte und zuverlässige Überwachungs- und Messergebnisse sind eine wesentliche Vorrausetzung für beherrschte Prozesse und die Einhaltung von Grenzwertvorgaben von Kunden und regelsetzenden Stellen (z. B. Behörden). Die Organisation muss daher sicherstellen, dass Ressourcen zur Überwachung und Messung geeignet sind,
| • | die geplante Messanforderung zu erfüllen, |
| • | die fortlaufende Qualität von Prozessen aufrechtzuerhalten. |
Im Fall der Anforderung nach messtechnischer Rückführbarkeit, um die Verwendbarkeit der Messmittel sicherzustellen, ist in bestimmten Abständen das Messmittel gegen eine normative oder sonstige dokumentierte Information zu prüfen. Sollten Zweifel an der Funktionsfähigkeit des Messmittels bestehen, ist dieses sofort einer Prüfung zu unterziehen. Mit einem zweifelhaften Messmittel getätigte Messungen sind zu verifizieren.
7.6.5 Wissensbezogene Ressourcen
Bezug: 9001/7.1.6 und 9004/9.3
Wissen ist der Schlüssel, um nachhaltige Prozesse durchzuführen und die von den interessierten Parteien erwarteten Qualitätsanforderungen an Produkte/Dienstleistungen und die Organisation zu erfüllen. Daher muss in einem IMS das notwendige Wissen ermittelt, vermittelt und aufrechterhalten werden. Das bestehende Wissen ist um mögliches zukünftiges Wissen regelmäßig zu erweitern. Dieses Wissen kann auf internen oder externen Quellen beruhen. Dazu zählt auch Erwerb von Wissen durch interessierte Parteien.
Wissen ist der Schlüssel, um nachhaltige Prozesse durchzuführen und die von den interessierten Parteien erwarteten Qualitätsanforderungen an Produkte/Dienstleistungen und die Organisation zu erfüllen. Daher muss in einem IMS das notwendige Wissen ermittelt, vermittelt und aufrechterhalten werden. Das bestehende Wissen ist um mögliches zukünftiges Wissen regelmäßig zu erweitern. Dieses Wissen kann auf internen oder externen Quellen beruhen. Dazu zählt auch Erwerb von Wissen durch interessierte Parteien.
Geistige Vermögenswerte
Die oberste Leitung sollte Wissen als geistige Vermögenswerte verstehen und den Erhalt und die Mehrung von Wissen fördern. Sie sollte Prozesse implementieren, wie das Wissen der Organisation identifiziert, erfasst, analysiert, aufrechterhalten und verfügbar gehalten wird. Dies schließt den Zugriff auf Wissen, seinen Schutz gegen unbefugten Zugriff und die Verwaltung von geistigem Eigentum mit ein. Über die Lenkung des Wissens sind dokumentierte Informationen zu führen.
Die oberste Leitung sollte Wissen als geistige Vermögenswerte verstehen und den Erhalt und die Mehrung von Wissen fördern. Sie sollte Prozesse implementieren, wie das Wissen der Organisation identifiziert, erfasst, analysiert, aufrechterhalten und verfügbar gehalten wird. Dies schließt den Zugriff auf Wissen, seinen Schutz gegen unbefugten Zugriff und die Verwaltung von geistigem Eigentum mit ein. Über die Lenkung des Wissens sind dokumentierte Informationen zu führen.
8.1 Betriebliche Planung und Steuerung
Bezug: IMS/8.1
Die Organisation muss die Prozesse zur Erfüllung der Anforderungen an das IMS unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen (IMS/6.1) planen, durchführen, steuern und aufrechterhalten. Dazu gehört die Festlegung betrieblicher Kriterien für die Prozesse, die Methoden der Steuerung dieser Prozesse und das Führen von dokumentierter Information, damit die Prozesse wie geplant umgesetzt und deren Ergebnisse festgehalten werden können. Die zur Umsetzung der Prozesse benötigten Ressourcen sind zu bestimmen.
Die Organisation muss die Prozesse zur Erfüllung der Anforderungen an das IMS unter Berücksichtigung von Risiken und Chancen (IMS/6.1) planen, durchführen, steuern und aufrechterhalten. Dazu gehört die Festlegung betrieblicher Kriterien für die Prozesse, die Methoden der Steuerung dieser Prozesse und das Führen von dokumentierter Information, damit die Prozesse wie geplant umgesetzt und deren Ergebnisse festgehalten werden können. Die zur Umsetzung der Prozesse benötigten Ressourcen sind zu bestimmen.
Ausgegliederte Prozesse müssen, soweit relevant, gesteuert und beeinflusst werden. Der Umfang der Steuerung ist durch die Organisation hinsichtlich der Bedeutung und des Risikos für die Organisation festzulegen.
Geplante Änderungen an den Prozessen oder ihrer Überwachung und Steuerung sind zu überwachen. Die Folgen ungeplanter Änderungen sind zu beurteilen und ggf. Maßnahmen zur Verhinderung oder Beseitigung von nachteiligen Auswirkungen zu ergreifen.
Über die betriebliche Planung und Steuerung sind dokumentierte Informationen aufrechtzuerhalten, die die Wirksamkeit der Steuerungsmaßnahmen belegen.
Anmerkung
Die über die gemeinsamen Anforderungen an das Normkapitel 8.1 hinausgehenden spezifischen Anforderungen der einzelnen Managementsysteme der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 sind den relevanten Normen zu entnehmen.
Die über die gemeinsamen Anforderungen an das Normkapitel 8.1 hinausgehenden spezifischen Anforderungen der einzelnen Managementsysteme der ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 sind den relevanten Normen zu entnehmen.
8.2.1 Allgemeines
Bezug: 9001/8.4, 14001/8.1, 45001/8.1.4 und 50001/8.3
Zielsetzung des Prozesses Beschaffung (ISO 9001: Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen) ist die Bereitstellung externer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, die den Anforderungen der Organisation vollumfänglich entsprechen und von dieser zur eigenen Leistungserbringung benötigt werden. Dazu sind die notwendigen Steuerungsmaßnahmen zu bestimmen.
Zielsetzung des Prozesses Beschaffung (ISO 9001: Steuerung von extern bereitgestellten Prozessen, Produkten und Dienstleistungen) ist die Bereitstellung externer Prozesse, Produkte und Dienstleistungen, die den Anforderungen der Organisation vollumfänglich entsprechen und von dieser zur eigenen Leistungserbringung benötigt werden. Dazu sind die notwendigen Steuerungsmaßnahmen zu bestimmen.
Hinsichtlich Beurteilung, Auswahl und Leistungsüberwachung von Lieferanten muss die Organisation geeignete Kriterien festlegen. Die Kriterien können je nach Bedeutung der zu beziehenden Produkte und Dienstleistung variieren. Externe (ausgelagerte) Prozesse müssen, soweit notwendig, einer Steuerung durch die Organisation unterliegen; der Umfang der Steuerung ist dabei nach definierten Kriterien festzulegen.
Die Organisation muss externen Anbietern ihre Anforderungen an das Produkt/Dienstleistung und an dessen Herstellung oder an die Leistungserbringung zweifelsfrei mitteilen. Dazu gehört auch die Lieferung von begleitender Dokumentation zu Qualität, Nutzung, Entsorgung etc.
Die spezifischen Anforderungen der ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 an die Beschaffung sind neben den allgemeinen Anforderungen der ISO 9001 ergänzend zu erfüllen.
8.2.2 Extern bereitgestellte Ressourcen
Bezug: 9004/9.6
Organisationen beschaffen extern bereitgestellte Ressourcen aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Quellen. Dabei ist die Art der Zusammenarbeit mit externen Partnern hinsichtlich ihrer Intensität und Zielrichtung unterschiedlich. Da sind zum einen die normalen Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und die Lieferanten, mit denen die Organisation ggf. eine vertiefte Zusammenarbeit in Form einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen eingeht.
Organisationen beschaffen extern bereitgestellte Ressourcen aus einer Vielzahl von unterschiedlichen Quellen. Dabei ist die Art der Zusammenarbeit mit externen Partnern hinsichtlich ihrer Intensität und Zielrichtung unterschiedlich. Da sind zum einen die normalen Lieferanten von Gütern und Dienstleistungen und die Lieferanten, mit denen die Organisation ggf. eine vertiefte Zusammenarbeit in Form einer Partnerschaft zum gegenseitigen Nutzen eingeht.
Normale Lieferanten
Der Umgang mit normalen Lieferanten ist unter „Allgemeines” (s. Abschnitt 8.2.1) behandelt worden und hinsichtlich seiner Anforderungen den Regelungen des IMS zuzuordnen.
Der Umgang mit normalen Lieferanten ist unter „Allgemeines” (s. Abschnitt 8.2.1) behandelt worden und hinsichtlich seiner Anforderungen den Regelungen des IMS zuzuordnen.
Strategische Partnerschaften
Das Schließen von strategischen Partnerschaften ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Organisationsführung und sollte in der Strategie des Unternehmens verankert sein. Die Organisation sollte Partnerschaften in Erwägung ziehen, wenn folgende Faktoren gegeben sind:
Das Schließen von strategischen Partnerschaften ist ein wichtiger Baustein einer nachhaltigen Organisationsführung und sollte in der Strategie des Unternehmens verankert sein. Die Organisation sollte Partnerschaften in Erwägung ziehen, wenn folgende Faktoren gegeben sind:
| • | Der Partner verfügt über Wissen, das für den Erfolg der Organisation von großer Bedeutung ist. |
| • | Beide Partner sind hinsichtlich ihrer Einbindung in eine gemeinsame Wertschöpfungskette wirtschaftlich stark miteinander verwoben. |
| • | Beide Partner haben einen wesentlichen Nutzen durch die Teilung von Markt- oder Produktrisiken, die die Möglichkeiten einer Partei übersteigen. |
| • | Wettbewerbsvorteile bei gegenseitiger Unterstützung im Hinblick auf die Teilung von Ressourcen und Wissen. |
Die Steuerung der Zusammenarbeit sollte auf gemeinsamen Strategien und Zielen beruhen, die ggf. auch gemeinsame Werte und abgestimmte Vorstellungen einer nachhaltigen Organisationsführung und des Wirtschaftens einschließen.
8.3.1 Anforderungen an Produkte und Dienstleistungen
Bezug: 9001/8.2
Die Organisation muss Regelungen zur Kommunikation mit dem Kunden treffen. Das schließt die Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen, den Umgang mit Anfragen, Verträgen und Aufträgen sowie Regelungen zur Steuerung von Kundeneigentum ein, des Weiteren den Umgang mit Rückmeldungen durch den Kunden (inkl. Kundenreklamation) zu Produkten, Dienstleistungen und wenn zutreffend, zu Anforderungen an Notfallmaßnahmen bezüglich der Lieferung.
Die Organisation muss Regelungen zur Kommunikation mit dem Kunden treffen. Das schließt die Bereitstellung von Informationen über Produkte und Dienstleistungen, den Umgang mit Anfragen, Verträgen und Aufträgen sowie Regelungen zur Steuerung von Kundeneigentum ein, des Weiteren den Umgang mit Rückmeldungen durch den Kunden (inkl. Kundenreklamation) zu Produkten, Dienstleistungen und wenn zutreffend, zu Anforderungen an Notfallmaßnahmen bezüglich der Lieferung.
Prüfung aller Anforderungen
Um eine bedarfsgerechte Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen sicher zu stellen, müssen die Anforderungen des Kunden an die Lieferung umfänglich ermittelt werden. Dazu gehören die vom Kunden spezifizierten Anforderungen, die vom ihm nicht genannten aber für den bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendigen Anforderungen und eigene Anforderungen, um das Produkt oder die Dienstleistung realisieren zu können. Außerdem können rechtlich/behördlich spezifizierte Anforderungen, die einzuhalten sind, dazu gehören. Nur nach einer positiven Prüfung aller Anforderungen kann die Organisation den Auftrag annehmen.
Um eine bedarfsgerechte Lieferung von Produkten oder Dienstleistungen sicher zu stellen, müssen die Anforderungen des Kunden an die Lieferung umfänglich ermittelt werden. Dazu gehören die vom Kunden spezifizierten Anforderungen, die vom ihm nicht genannten aber für den bestimmungsgemäßen Gebrauch notwendigen Anforderungen und eigene Anforderungen, um das Produkt oder die Dienstleistung realisieren zu können. Außerdem können rechtlich/behördlich spezifizierte Anforderungen, die einzuhalten sind, dazu gehören. Nur nach einer positiven Prüfung aller Anforderungen kann die Organisation den Auftrag annehmen.
Auftragsklärung
Differenzen zwischen vorherigen Anforderungen und neuen Anforderungen sind mit dem Kunden zu klären. Wenn keine detaillierten dokumentierten Kundenanforderungen vorhanden, oder diese unzureichend sind, muss der genaue Lieferumfang durch die Organisation bestätigt werden (z. B. Auftragsbestätigung).
Differenzen zwischen vorherigen Anforderungen und neuen Anforderungen sind mit dem Kunden zu klären. Wenn keine detaillierten dokumentierten Kundenanforderungen vorhanden, oder diese unzureichend sind, muss der genaue Lieferumfang durch die Organisation bestätigt werden (z. B. Auftragsbestätigung).
Die Organisation muss dokumentierte Informationen im erforderlichen Umfang über die Auftragsklärung und Auftragsannahme erstellen und aufbewahren. Bei Änderungen von Anforderungen an Produkt oder Dienstleistung sind diese ebenso zu prüfen, freizugeben und zu dokumentieren.
8.3.2 Entwicklung
Bezug: 9001/8.3
Wenn eine Organisation Entwicklung betreibt, hat sie einen Entwicklungsprozess einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Der Prozess soll die Erfüllung der Anforderungen an das Entwicklungsprodukt und an die spätere Produktion oder Dienstleistungserbringung sicherstellen.
Wenn eine Organisation Entwicklung betreibt, hat sie einen Entwicklungsprozess einzurichten, umzusetzen und aufrechtzuerhalten. Der Prozess soll die Erfüllung der Anforderungen an das Entwicklungsprodukt und an die spätere Produktion oder Dienstleistungserbringung sicherstellen.
Entwicklungsplanung
Im Rahmen der Entwicklungsplanung muss die Organisation alle Phasen der Entwicklung sowie die anzuwendenden Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen bestimmen. Ebenso sind alle Ressourcen und an der Entwicklung Beteiligten inkl. ihrer Kompetenz festzulegen.
Im Rahmen der Entwicklungsplanung muss die Organisation alle Phasen der Entwicklung sowie die anzuwendenden Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen bestimmen. Ebenso sind alle Ressourcen und an der Entwicklung Beteiligten inkl. ihrer Kompetenz festzulegen.
Im Rahmen der Definition der Entwicklungseingaben hat die Organisation alle Funktions- und Leistungsanforderungen an das Entwicklungsprodukt (oder an die Dienstleistung) inkl. gesetzlicher/behördlicher und normativer oder sonstigen Standards zu bestimmen.
Überwachen, steuern und überprüfen
Der Entwicklungsprozess muss durch geeignete Maßnahmen überwacht und gesteuert werden. Das Ausmaß der Steuerung bezieht sich auf die notwendigen Überwachungstätigkeiten sowie Verifizierungs- und Validierungstätigkeiten. Die Organisation muss die Entwicklungsergebnisse im Hinblick auf die Entwicklungsziele und die bei den Entwicklungseingaben gemachten Vorgaben durch Soll-Ist-Vergleich verifizieren, ob das Produkt oder die Dienstleistung für die geplante Produktion oder Leistungserbringung geeignet ist und eine sichere Verwendung gewährleistet ist.
Der Entwicklungsprozess muss durch geeignete Maßnahmen überwacht und gesteuert werden. Das Ausmaß der Steuerung bezieht sich auf die notwendigen Überwachungstätigkeiten sowie Verifizierungs- und Validierungstätigkeiten. Die Organisation muss die Entwicklungsergebnisse im Hinblick auf die Entwicklungsziele und die bei den Entwicklungseingaben gemachten Vorgaben durch Soll-Ist-Vergleich verifizieren, ob das Produkt oder die Dienstleistung für die geplante Produktion oder Leistungserbringung geeignet ist und eine sichere Verwendung gewährleistet ist.
Notwendige Entwicklungsänderungen sind von der Organisation bezüglich des Umfangs so zu ermitteln, zu steuern und zu überprüfen, dass daraus keine nachteiligen Auswirkungen auf das sichere und konforme Entwicklungsergebnis entstehen können.
Über alle Phasen der Entwicklung muss die Organisation in notwendigem Umfang dokumentierte Informationen erstellen und aufbewahren.
Anmerkung:
Im Rahmen des Entwicklungsprozesses der ISO 9001 muss sichergestellt sein, dass Umweltanforderungen an Produkte und Dienstleistungen angemessen berücksichtigt werden. Darin sind auch Umweltauswirkungen des geplanten Lebenswegs einzubeziehen (14001/8.1a).
Im Rahmen des Entwicklungsprozesses der ISO 9001 muss sichergestellt sein, dass Umweltanforderungen an Produkte und Dienstleistungen angemessen berücksichtigt werden. Darin sind auch Umweltauswirkungen des geplanten Lebenswegs einzubeziehen (14001/8.1a).
8.3.3 Produktion und Dienstleistungserbringung
Bezug: 9001/8.5
Die Produktion und Dienstleistungserbringung müssen unter beherrschten Bedingungen geschehen. Das schließt die Verfügbarkeit der notwendigen dokumentierten Information, Infrastruktur und Personen ein. Auch alle Überwachungstätigkeiten und das dazu benötigte Equipment müssen vorhanden sein. Die Steuerung der Produktion- und der Dienstleistungserbringung muss die Überwachung der Fertigungsschritte und Freigaben während und nach der Fertigung einschließen.
Die Produktion und Dienstleistungserbringung müssen unter beherrschten Bedingungen geschehen. Das schließt die Verfügbarkeit der notwendigen dokumentierten Information, Infrastruktur und Personen ein. Auch alle Überwachungstätigkeiten und das dazu benötigte Equipment müssen vorhanden sein. Die Steuerung der Produktion- und der Dienstleistungserbringung muss die Überwachung der Fertigungsschritte und Freigaben während und nach der Fertigung einschließen.
Die Organisationen muss die Kennzeichnung von Produkten und Dienstleistungen während der Entstehungsprozesse sicherstellen. Die Kennzeichnung muss den Status der Wertschöpfung und der Überwachung (Messung) nachvollziehbar machen. Wenn Rückverfolgbarkeit gefordert ist, muss die Organisation die eindeutige Kennzeichnung der Produkte sicherstellen und dokumentierte Informationen darüber aufbewahren, so dass Rückverfolgbarkeit möglich wird.
Fremdeigentum
Eigentum von Kunden oder Lieferanten, das sich in der Verfügungsgewalt der Organisation befindet und für die Produktion oder Dienstleistungserbringung benötigt wird, ist sorgsam zu behandeln. Es muss gekennzeichnet und hinsichtlich der Verwendungsfähigkeit verifiziert sowie bei der Aufbewahrung geschützt werden. Bei Verlust oder Beschädigung ist das dem Eigentümer umgehend mitzuteilen.
Eigentum von Kunden oder Lieferanten, das sich in der Verfügungsgewalt der Organisation befindet und für die Produktion oder Dienstleistungserbringung benötigt wird, ist sorgsam zu behandeln. Es muss gekennzeichnet und hinsichtlich der Verwendungsfähigkeit verifiziert sowie bei der Aufbewahrung geschützt werden. Bei Verlust oder Beschädigung ist das dem Eigentümer umgehend mitzuteilen.
Die Qualitätsmerkmale von Produkten und Dienstleistungen während der Entstehung müssen in dem Umfang erhalten bleiben, dass die Übereinstimmung mit den Anforderungen gesichert ist.
Tätigkeiten nach der Lieferung von Produkten und Dienstleistungen (z. B. Montage, Service, Produktverantwortung) müssen den vereinbarten Anforderungen entsprechen. Dazu gehören rechtliche Anforderungen wie auch unerwünschte Auswirkungen bei der Nutzung im Rahmen des Lebenszyklus. Eingeschlossen darin sind auch Kundenanforderungen und Kundenrückmeldungen.
8.3.4 Freigabe von Produkten und Dienstleistungen
Bezug: 9001/8.6
Bei der Freigabe von Produkten sind zu unterscheiden, die Produktfreigabe während der Erzeugung (Zwischenprüfung) und die Freigabe zur Kundenauslieferung (Endprüfung). In beiden Fällen muss anhand festgelegter Prüfkriterien die Erfüllung der Anforderungen festgestellt werden. In vereinbarten Fällen ist bei der Freigabe zur Auslieferung eine Freigabe durch den Kunden oder eine festgelegte Stelle (z. B. externe Abnahme) erforderlich.
Bei der Freigabe von Produkten sind zu unterscheiden, die Produktfreigabe während der Erzeugung (Zwischenprüfung) und die Freigabe zur Kundenauslieferung (Endprüfung). In beiden Fällen muss anhand festgelegter Prüfkriterien die Erfüllung der Anforderungen festgestellt werden. In vereinbarten Fällen ist bei der Freigabe zur Auslieferung eine Freigabe durch den Kunden oder eine festgelegte Stelle (z. B. externe Abnahme) erforderlich.
Über die Freigabe zur Lieferung ist eine dokumentierte Information durch die Organisation zu erstellen, aufzubewahren und wenn vereinbart, dem Kunden zu übergeben. Darin enthalten sein müssen der Konformitätsnachweis mit den Anforderungen und die Rückverfolgbarkeit zur Person, die die Freigabe erteilt hat.
8.3.5 Steuerung nichtkonformer Ergebnisse
Bezug: 9001/8.7
Nichtkonforme Ergebnisse bei Produkten und Dienstleistungen müssen wenn möglich gekennzeichnet und der weitere Umgang mit ihnen muss gesteuert werden, um die Auslieferung oder den unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern.
Nichtkonforme Ergebnisse bei Produkten und Dienstleistungen müssen wenn möglich gekennzeichnet und der weitere Umgang mit ihnen muss gesteuert werden, um die Auslieferung oder den unbeabsichtigten Gebrauch zu verhindern.
Geeignete Maßnahmen, um die Verbreitung nicht konformer Produkte oder Dienstleistungen zu verhindern, müssen ergriffen werden. Dies gilt auch für nicht konforme Produkte und Dienstleistungen nach der Auslieferung oder während der Dienstleistungserbringung.
Die Art des Umgangs mit der Nichtkonformität ist festzulegen (z. B. Korrektur, Verschrottung, Sonderfreigabe), ggf. unter Mitwirkung des Kunden. Über die Nichtkonformität und den Umgang mit derselben sind dokumentierte Informationen zu erstellen und aufzubewahren. Darin müssen auch Personen dokumentiert sein, die die Entscheidungen im Umgang mit der Nichtkonformität zu verantworten haben.
8.3.6 Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr
Bezug: 14001/8.2
Für Risiken, die zu potenziellen Notfällen für die Umwelt führen können, muss die Organisation Prozesse des Umgangs und der Vorsorge entwickeln und aufrechterhalten. Dazu gehören Instrumente der Gefahrenabwehr, um das Eintreten eines Notfalls zu minimieren, genauso wie die Notfallvorsorge, bei der es um das Managen des Notfalls geht, mit dem Ziel einer Begrenzung des Schadens. Diese Maßnahmen sind regelmäßig und bei besonderen Anlässen zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten. Wenn praktikabel, sind sie auch regelmäßig zu testen.
Für Risiken, die zu potenziellen Notfällen für die Umwelt führen können, muss die Organisation Prozesse des Umgangs und der Vorsorge entwickeln und aufrechterhalten. Dazu gehören Instrumente der Gefahrenabwehr, um das Eintreten eines Notfalls zu minimieren, genauso wie die Notfallvorsorge, bei der es um das Managen des Notfalls geht, mit dem Ziel einer Begrenzung des Schadens. Diese Maßnahmen sind regelmäßig und bei besonderen Anlässen zu überprüfen und ggf. zu überarbeiten. Wenn praktikabel, sind sie auch regelmäßig zu testen.
Maßnahmen bezüglich Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr sind interessierten Parteien und Personen über Informationen und Unterweisungen zugänglich zu machen. In notwendigem Umfang sind dokumentierte Informationen über Planung und Umsetzung der Notfallvorsorge und Gefahrenabwehr aufrechtzuerhalten.
8.3.7 Gefahren beseitigen und SGA-Risiken verringern
Bezug: 45001/8.1.2
Zur Beseitigung und Verringerung von betrieblichen Gefahren und Risiken für Personen und deren Gesundheit muss die Organisation Prozesse einrichten und aufrechterhalten. Die Maßnahmen sind entsprechend dem Risiko abgestuft zu ergreifen. Gefährliches ist durch weniger Gefährliches zu substituieren, Schutz durch technische Maßnahmen kommt vor organisatorischen Maßnahmen und dem Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Maßnahmenhierarchie nach TOP-Prinzip). Rechtlich geforderte Schutzmaßnahmen sind bindend.
Zur Beseitigung und Verringerung von betrieblichen Gefahren und Risiken für Personen und deren Gesundheit muss die Organisation Prozesse einrichten und aufrechterhalten. Die Maßnahmen sind entsprechend dem Risiko abgestuft zu ergreifen. Gefährliches ist durch weniger Gefährliches zu substituieren, Schutz durch technische Maßnahmen kommt vor organisatorischen Maßnahmen und dem Einsatz von persönlicher Schutzausrüstung (Maßnahmenhierarchie nach TOP-Prinzip). Rechtlich geforderte Schutzmaßnahmen sind bindend.
8.3.8 Änderungsmanagement
Bezug: 45001/8.1.3
Im Fall von dauerhaften oder vorübergehenden Änderungen an Arbeitsprozessen sind die Auswirkung auf die SGA-Leistung vor der Änderung zu untersuchen. Änderungen können sein andere Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel oder Arbeitskräfte. Bei Änderungen, die auch die Sicherheit betreffen, sind neue oder erweiterte Schutzmaßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Im Fall von dauerhaften oder vorübergehenden Änderungen an Arbeitsprozessen sind die Auswirkung auf die SGA-Leistung vor der Änderung zu untersuchen. Änderungen können sein andere Arbeitsorganisation, Arbeitsbedingungen, Arbeitsmittel oder Arbeitskräfte. Bei Änderungen, die auch die Sicherheit betreffen, sind neue oder erweiterte Schutzmaßnahmen festzulegen und umzusetzen.
Unbeabsichtigte Änderungen sind hinsichtlich des daraus entstehenden Risikos zu bewerten und Schutzmaßnahmen zur Beseitigung oder Abschwächung des Risikos durch die Organisation zu ergreifen.
8.3.9 Notfallplanung und Reaktion
Bezug: 45001/8.2
Es müssen Prozesse festgelegt werden im Umgang mit Risiken, die zu Notfällen hinsichtlich der Gesundheit von Personen werden können. Es sind Reaktionen auf mögliche Unfallszenarien zu planen, inkl. Erste-Hilfe-Maßnahmen. Für die Personen der Organisation und betroffene interessierte Parteien müssen Schulungen/Unterweisungen zu den Reaktionsmaßnahmen bereitgestellt werden.
Es müssen Prozesse festgelegt werden im Umgang mit Risiken, die zu Notfällen hinsichtlich der Gesundheit von Personen werden können. Es sind Reaktionen auf mögliche Unfallszenarien zu planen, inkl. Erste-Hilfe-Maßnahmen. Für die Personen der Organisation und betroffene interessierte Parteien müssen Schulungen/Unterweisungen zu den Reaktionsmaßnahmen bereitgestellt werden.
Die Wirksamkeit der Notfallplanung muss in regelmäßigen Abständen getestet werden. Leistungsbewertung und Reaktionsmaßnahmen der SGA-Vorsorge sind zu überprüfen und ggf. anzupassen.
Es ist eine Kommunikation hinsichtlich der Pflichten und Verantwortlichkeiten der Mitarbeiter im Arbeits- und Gesundheitsschutz einzurichten. Ebenso ist die Kommunikation mit Auftragnehmern, Besuchern, Notfalldiensten oder anderen interessierten Parteien zu führen und ggf. deren Beteiligung sicherzustellen.
Zu den SGA-Prozessen, Notfallplänen und andere relevante Regelungen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz sind dokumentierte Informationen aufrechtzuerhalten.
8.3.10 Auslegung
Bezug: 50001/8.2
Die Organisation muss bei der Auslegung neuer, veränderter oder renovierter Einrichtungen und Anlagen mit Energieeinsatz die Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz berücksichtigen, wenn diese einen wesentlichen Einfluss auf die energiebezogene Leistung der Organisation über die geplante oder erwartete Nutzungsdauer hat.
Die Organisation muss bei der Auslegung neuer, veränderter oder renovierter Einrichtungen und Anlagen mit Energieeinsatz die Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz berücksichtigen, wenn diese einen wesentlichen Einfluss auf die energiebezogene Leistung der Organisation über die geplante oder erwartete Nutzungsdauer hat.
Ergebnisse dieser Analyse müssen in die weiterführenden Investitions- und/oder Beschaffungstätigkeiten hinsichtlich der Energieeffizienz einfließen. Über die Analyse und weitere Auslegungstätigkeiten sind dokumentierte Informationen zu erstellen.
9.1.1 Allgemeines
Bezug: IMS/9.9.1 und 9004/10.1
Die Organisation muss einen systematischen Ansatz zur Erfassung, Analyse und Überprüfung von Daten und Informationen festlegen, die zur Konformitäts- oder Leistungsbewertung von Prozessen, Produkten und Dienstleistung dienen sollen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse und Informationen sollten zur Leistungsverbesserung und zur Steigerung der Nachhaltigkeit der Organisation genutzt werden.
Die Organisation muss einen systematischen Ansatz zur Erfassung, Analyse und Überprüfung von Daten und Informationen festlegen, die zur Konformitäts- oder Leistungsbewertung von Prozessen, Produkten und Dienstleistung dienen sollen. Die daraus gewonnenen Ergebnisse und Informationen sollten zur Leistungsverbesserung und zur Steigerung der Nachhaltigkeit der Organisation genutzt werden.
Was, Wann, Wo, Wie
Dabei muss festgelegt werden, was, wann, wo, wie gemessen wird und wie die Analyse der ermittelten Daten zu erfolgen hat. Anhand der Daten von Prozessen und Produkten/Dienstleistungen (z. B. Kennzahlen) ist eine Bewertung der Wirksamkeit des IMS und ggf. des erreichten Status der Nachhaltigkeit möglich.
Dabei muss festgelegt werden, was, wann, wo, wie gemessen wird und wie die Analyse der ermittelten Daten zu erfolgen hat. Anhand der Daten von Prozessen und Produkten/Dienstleistungen (z. B. Kennzahlen) ist eine Bewertung der Wirksamkeit des IMS und ggf. des erreichten Status der Nachhaltigkeit möglich.
Zur Überwachung, Messung, Analyse und Bewertung sind geeignete dokumentierte Informationen zu führen.
9.1.2 Leistungsindikatoren
Bezug: 9004/10.2
Die Auswahl geeigneter Leistungsindikatoren, auch als Key Performance Indicator (KPI) bezeichnet und geeigneter Messverfahren ist entscheidend für die wirksame Messung und Analyse von Prozessen sowie Produkten/Dienstleistungen einer Organisation. Die angewendeten Verfahren zur Erfassung von Leistungsindikatoren sollten praktikabel und geeignet sein zur Bewertung von Prozessvariablen sowie internen und externen Risiken der Organisation. Faktoren, die für die Organisation zur Bewertung der Leistung von wesentlicher Bedeutung sind, sollten als Schlüsselleistungskennzahlen identifiziert werden. An die Qualität dieser Kennzahlen sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Zuverlässigkeit besondere Ansprüche zu stellen. Leistungsindikatoren sollten die Erfolgsfaktoren der Organisation bezüglich z. B. Produkten/Dienstleistungen, Prozessen, interessierten Parteien, Risiken und Chancen, effizienter Nutzung von Ressourcen und finanzieller Ergebnisse transparent machen.
Die Auswahl geeigneter Leistungsindikatoren, auch als Key Performance Indicator (KPI) bezeichnet und geeigneter Messverfahren ist entscheidend für die wirksame Messung und Analyse von Prozessen sowie Produkten/Dienstleistungen einer Organisation. Die angewendeten Verfahren zur Erfassung von Leistungsindikatoren sollten praktikabel und geeignet sein zur Bewertung von Prozessvariablen sowie internen und externen Risiken der Organisation. Faktoren, die für die Organisation zur Bewertung der Leistung von wesentlicher Bedeutung sind, sollten als Schlüsselleistungskennzahlen identifiziert werden. An die Qualität dieser Kennzahlen sind hinsichtlich ihrer Genauigkeit und Zuverlässigkeit besondere Ansprüche zu stellen. Leistungsindikatoren sollten die Erfolgsfaktoren der Organisation bezüglich z. B. Produkten/Dienstleistungen, Prozessen, interessierten Parteien, Risiken und Chancen, effizienter Nutzung von Ressourcen und finanzieller Ergebnisse transparent machen.
9.1.3 Leistungsanalyse
Bezug: 9004/10.3
Die Leistungsanalyse kann der Organisation ihre Stärken und Schwächen offenlegen. Daher sollte sie über ein Rahmenwerk verfügen, das die Wechselbeziehung zwischen Führungstätigkeiten und deren Auswirkung auf die Leistung der Organisation methodisch transparent macht, z. B. mittels Balanced Sore Card (BSC). Die Statusbestimmung der Leistung kann Anlass für weitere Verbesserungsmaßnahmen sein.
Die Leistungsanalyse kann der Organisation ihre Stärken und Schwächen offenlegen. Daher sollte sie über ein Rahmenwerk verfügen, das die Wechselbeziehung zwischen Führungstätigkeiten und deren Auswirkung auf die Leistung der Organisation methodisch transparent macht, z. B. mittels Balanced Sore Card (BSC). Die Statusbestimmung der Leistung kann Anlass für weitere Verbesserungsmaßnahmen sein.
9.1.4 Leistungsbewertung
Bezug: 9004/10.4
Ein wesentlicher Punkt für die Leistungsbewertung der Organisation sollte die Sichtweise der interessierten Parteien hinsichtlich der Erfüllung ihrer Anforderungen und Erwartung sein. Des Weiteren sollte die Erreichung von strategischen und operativen Zielen im Fokus der Leistungsbewertung stehen. Um eine nachhaltige Entwicklung abzusichern, sollte die Leistungsbewertung aus der langfristigen Perspektive betrachtet werden und mit festgelegten Referenzwerten der Vergangenheit (internen/externen Werten) als Ausgangsbasis verglichen werden.
Ein wesentlicher Punkt für die Leistungsbewertung der Organisation sollte die Sichtweise der interessierten Parteien hinsichtlich der Erfüllung ihrer Anforderungen und Erwartung sein. Des Weiteren sollte die Erreichung von strategischen und operativen Zielen im Fokus der Leistungsbewertung stehen. Um eine nachhaltige Entwicklung abzusichern, sollte die Leistungsbewertung aus der langfristigen Perspektive betrachtet werden und mit festgelegten Referenzwerten der Vergangenheit (internen/externen Werten) als Ausgangsbasis verglichen werden.
Korrekturmaßnahmen
Die Organisation sollte bei Abweichungen vom Soll zielführende Maßnahmen zur Korrektur einleiten. Wenn notwendig sollte die Leistungsbewertungsmethode überprüft und ggf. geändert werden. Zur Leistungsbewertung und ihren Grundlagen ist eine dokumentierte Information zu führen.
Die Organisation sollte bei Abweichungen vom Soll zielführende Maßnahmen zur Korrektur einleiten. Wenn notwendig sollte die Leistungsbewertungsmethode überprüft und ggf. geändert werden. Zur Leistungsbewertung und ihren Grundlagen ist eine dokumentierte Information zu führen.
9.2.1 Internes Audit
Bezug: IMS/9.2 und 9004/10.5
Interne Audits sind ein wirksames Werkzeug um den Grad der Konformität des IMS der Organisation mit den Kriterien der zugrundeliegenden Normen zu bestimmen. Die Audits liefern wertvolle Informationen zu Stärken und Schwächen der Leistung des IMS sowie ggf. zum vorhandenen Verbesserungspotenzial.
Interne Audits sind ein wirksames Werkzeug um den Grad der Konformität des IMS der Organisation mit den Kriterien der zugrundeliegenden Normen zu bestimmen. Die Audits liefern wertvolle Informationen zu Stärken und Schwächen der Leistung des IMS sowie ggf. zum vorhandenen Verbesserungspotenzial.
Planen und umgesetzen
Interne Audits zum IMS müssen in geplanten Abständen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das IMS die Anforderungen der zugrunde liegenden Normen erfüllt. Dazu muss/müssen ein oder mehrere Auditprogramm(e) geplant und umgesetzt werden, das/die die gesamte Breite des IMS abdeckt/-en. Die Audits können getrennt nach Systemen oder integrativ als IMS durchgeführt werden. Für die Audits sind Umfang, Auditkriterien, Häufigkeit und Verantwortlichkeit festzulegen. Thematische Schwerpunkte für das Audit sind festzulegen anhand der Bedeutung der Prozesse und der Ergebnisse vorheriger Audits. Die Ergebnisse der Audits sind als dokumentierte Information an die Leitung zu kommunizieren.
Interne Audits zum IMS müssen in geplanten Abständen durchgeführt werden, um zu prüfen, ob das IMS die Anforderungen der zugrunde liegenden Normen erfüllt. Dazu muss/müssen ein oder mehrere Auditprogramm(e) geplant und umgesetzt werden, das/die die gesamte Breite des IMS abdeckt/-en. Die Audits können getrennt nach Systemen oder integrativ als IMS durchgeführt werden. Für die Audits sind Umfang, Auditkriterien, Häufigkeit und Verantwortlichkeit festzulegen. Thematische Schwerpunkte für das Audit sind festzulegen anhand der Bedeutung der Prozesse und der Ergebnisse vorheriger Audits. Die Ergebnisse der Audits sind als dokumentierte Information an die Leitung zu kommunizieren.
Die Auditoren sollten unabhängig und kompetent sein. Wenn notwendig sind bei Abweichungen geeignete Korrekturmaßnahmen ohne ungerechtfertigte Verzögerung umzusetzen. Interne Audits können auf der Basis der ISO 19011 durchgeführt werden. Dokumentierte Informationen sind zur Nachweisführung für die Umsetzung des Auditprogramms und seiner Ergebnisse zu führen.
9.2.2 Selbstbewertung
Bezug: 9004/10.6
Die Selbstbewertung ist ein Instrument der Leistungsbewertung auf dem Weg zur Erreichung des nachhaltigen Erfolgs einer Organisation. Neben der Erfüllung der Anforderungen von Managementsystemen ist auch die Erfüllung der Forderungen und Erwartungen von interessierten Parteien ein zentrales Anliegen der Leistungsbewertung nach ISO 9004. Im Hinblick auf das Endziel Best Practice spielen auch die Ziele und deren Erfüllungsgrad eine große Rolle in der Leistungsbewertung, wobei die erreichten Verbesserungen der Leistung im Sinne der Nachhaltigkeit aus einer langfristigen Perspektive bewertet werden sollen.
Die Selbstbewertung ist ein Instrument der Leistungsbewertung auf dem Weg zur Erreichung des nachhaltigen Erfolgs einer Organisation. Neben der Erfüllung der Anforderungen von Managementsystemen ist auch die Erfüllung der Forderungen und Erwartungen von interessierten Parteien ein zentrales Anliegen der Leistungsbewertung nach ISO 9004. Im Hinblick auf das Endziel Best Practice spielen auch die Ziele und deren Erfüllungsgrad eine große Rolle in der Leistungsbewertung, wobei die erreichten Verbesserungen der Leistung im Sinne der Nachhaltigkeit aus einer langfristigen Perspektive bewertet werden sollen.
Zu berücksichtigen
Für eine effektive Leistungsbewertung sollte die Organisation Folgendes berücksichtigen:
Für eine effektive Leistungsbewertung sollte die Organisation Folgendes berücksichtigen:
| • | Die Leistung sollte mit vereinbarten Referenzwerten verglichen werden. |
| • | Die Methodik für die Leistungsvergleiche sollte definiert werden. |
| • | Die verschiedenen Arten von Leistungsvergleichspraktiken sollten berücksichtigt werden. |
| • | Die Faktoren für einen Leistungsvergleich sollten bestimmt werden. |
Ergebnisse kommunizieren
Über die Ergebnisse der Leistungsentwicklung ist die oberste Leitung zu informieren, damit diese die notwendigen Maßnahmen im Hinblick auf Korrekturmaßnahmen und die Auswirkungen auf Vision, Mission, Politik, Strategie und Ziele der Organisation treffen kann. Des Weiteren sind die Ergebnisse allen relevanten Personen mitzuteilen, die für die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses der Organisation zur Nachhaltigkeit und deren zukünftige Entwicklung wichtig sind.
Über die Ergebnisse der Leistungsentwicklung ist die oberste Leitung zu informieren, damit diese die notwendigen Maßnahmen im Hinblick auf Korrekturmaßnahmen und die Auswirkungen auf Vision, Mission, Politik, Strategie und Ziele der Organisation treffen kann. Des Weiteren sind die Ergebnisse allen relevanten Personen mitzuteilen, die für die Schaffung eines gemeinsamen Verständnisses der Organisation zur Nachhaltigkeit und deren zukünftige Entwicklung wichtig sind.
Die Vorgehensweise der Selbstbewertung ist gemäß der ISO 9004 unter „Methode zur Selbstbewertung” (s. Abschnitt 11) näher ausgeführt.
9.3.1 Managementbewertung
Bezug: IMS/9.3
In geplanten Abständen hat die oberste Leitung das IMS der Organisation zu bewerten und, wenn notwendig, Korrekturen zur Verbesserung der Wirksamkeit des IMS vorzunehmen. Ggf. sind auch Änderung an der strategischen Ausrichtung der Organisation notwendig.
In geplanten Abständen hat die oberste Leitung das IMS der Organisation zu bewerten und, wenn notwendig, Korrekturen zur Verbesserung der Wirksamkeit des IMS vorzunehmen. Ggf. sind auch Änderung an der strategischen Ausrichtung der Organisation notwendig.
Wesentlich für die Managementbewertung sind die Eingaben in die Bewertung, denn diese umfassen alle wesentlichen Themen die in Summe über die Wirksamkeit des IMS Aufschluss geben, z. B. die Prozessleistung oder Möglichkeiten der Verbesserung. Details der Eingaben sind den spezifischen Managementsystemnormen zu entnehmen.
Die Ergebnisse der Managementbewertung umfassen Entscheidungen bezüglich der Notwendigkeit Änderungen am IMS vorzunehmen, Möglichkeiten zur Verbesserung des IMS und seiner Prozesse mittels Zielen festzulegen oder Änderungen an der Ressourcenzuteilung vorzunehmen. Aus den spezifischen Themen der Einzelnormen des IMS können noch weitere Ergebnisse für die Managementbewertung anfallen.
9.3.2 Überprüfung
Bezug: 9004/10.7
Die regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse interner Audits und der Selbstbewertung sollte durch die oberste Leitung vorgenommen werden, um die Wirksamkeit der Organisationsprozesse und die Erreichung von Zielen zu bewerten. Die Managementbewertung umfasst im engeren Sinne nur die Themen die im Kapitel 9.3 der Zertifizierungsnormen vorgegeben sind. Eine umfängliche Überprüfung der Umsetzung der ISO 9004 ist darin nicht zwangsläufig enthalten, insbesondere für die Themen, zu denen es keine Entsprechung in den Zertifizierungsnormen gibt.
Die regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse interner Audits und der Selbstbewertung sollte durch die oberste Leitung vorgenommen werden, um die Wirksamkeit der Organisationsprozesse und die Erreichung von Zielen zu bewerten. Die Managementbewertung umfasst im engeren Sinne nur die Themen die im Kapitel 9.3 der Zertifizierungsnormen vorgegeben sind. Eine umfängliche Überprüfung der Umsetzung der ISO 9004 ist darin nicht zwangsläufig enthalten, insbesondere für die Themen, zu denen es keine Entsprechung in den Zertifizierungsnormen gibt.
Die Überprüfung sollte daher wichtige Themen umfassen, wie sie im Abschnitt 3 „Wesen der Organisation” genannt sind, ebenso wie die Bewertung und Beurteilung der zuvor durchgeführten Verbesserungs-, Lern- und Innovationstätigkeiten einschließlich der Aspekte der Anpassungsfähigkeit, der Flexibilität und der Reaktivität in Bezug auf die Mission, die Vision, die Werte und die Kultur der Organisation.
Rückschlüsse ziehen
Aus dieser Bewertung können Schlüsse gezogen werden, ob die bestehende Strategie, die Politik und oder die Ziele an zukünftige Entwicklungen angepasst werden müssen. Darüber hinaus sollte sie genutzt werden, um Verbesserungs-, Lern- und Innovationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Führungstätigkeiten der Organisation zu bestimmen.
Aus dieser Bewertung können Schlüsse gezogen werden, ob die bestehende Strategie, die Politik und oder die Ziele an zukünftige Entwicklungen angepasst werden müssen. Darüber hinaus sollte sie genutzt werden, um Verbesserungs-, Lern- und Innovationsmöglichkeiten im Hinblick auf die Führungstätigkeiten der Organisation zu bestimmen.
Das Ergebnis der Überprüfung kann integrativ unter den beiden zusätzlichen Ergebnispunkten „Nachhaltige Entwicklung” und „Änderungen an Vision und Mission” in der Managementbewertung behandelt werden.
9.4.1 Kundenzufriedenheit
Bezug: 9001/9.1.2
Die Wahrnehmungen des Kunden bezüglich des Erfüllungsgrads seiner Anforderungen und Erwartungen ist für die Organisation von immenser Bedeutung. Sie muss daher Methoden zum Einholen, Überwachen und Überprüfen der Kundenmeinung entwickeln und umsetzen. Das Ergebnis der Ermittlung der Kundenzufriedenheit ist als dokumentierte Information aufzubewahren.
Die Wahrnehmungen des Kunden bezüglich des Erfüllungsgrads seiner Anforderungen und Erwartungen ist für die Organisation von immenser Bedeutung. Sie muss daher Methoden zum Einholen, Überwachen und Überprüfen der Kundenmeinung entwickeln und umsetzen. Das Ergebnis der Ermittlung der Kundenzufriedenheit ist als dokumentierte Information aufzubewahren.
9.4.2 Bewertung der Einhaltung rechtlicher und sonstiger Verpflichtungen
Bezug: 14001, 45001 und 50001/9.1.2
Für die Bewertung bindender Verpflichtungen muss die Organisation Prozesse einrichten, die ihr Auskunft geben über die Konformität mit der sie ihre bindenden Verpflichtungen erfüllt. Bindende Verpflichtungen ergeben sich aus den Anforderungen regelsetzender Stellen (Gesetzgeber, Behörden) an die Organisation oder aus freiwillig eingegangenen Verpflichtungen (z. B. Nachhaltigkeit).
Für die Bewertung bindender Verpflichtungen muss die Organisation Prozesse einrichten, die ihr Auskunft geben über die Konformität mit der sie ihre bindenden Verpflichtungen erfüllt. Bindende Verpflichtungen ergeben sich aus den Anforderungen regelsetzender Stellen (Gesetzgeber, Behörden) an die Organisation oder aus freiwillig eingegangenen Verpflichtungen (z. B. Nachhaltigkeit).
Die Organisation muss die Häufigkeit der Überprüfung bestimmen (ggf. in Abhängigkeit von der Bedeutung der bindenden Verpflichtung für die Organisation). Fällt das Ergebnis der Überprüfung negativ aus, sind umgehend wirksame Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Die Ergebnisse der Bewertung müssen als dokumentierte Information aufbewahrt werden.
10.1 Allgemeines
Bezug: IMS/10.1 (nicht 50001) und 9004/11.1
Verbesserung ist eine Tätigkeit, um Leistung zu steigern. Das kann sich auf Produkte/Dienstleistungen, Prozesse, Managementsysteme oder die Wirtschaftlichkeit beziehen. Die Organisation muss mögliche Maßnahmen zur Verbesserung festlegen und verwirklichen, um die beabsichtigten Ergebnisse des IMS zu erreichen. Dazu gehören auch das Korrigieren, Verhindern oder Verringern von unerwünschten Auswirkungen sowie die Erfüllung zukünftiger Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien. Verbesserung kann in kleinen Schritten (stetig) oder in größeren Sprüngen erfolgen.
Verbesserung ist eine Tätigkeit, um Leistung zu steigern. Das kann sich auf Produkte/Dienstleistungen, Prozesse, Managementsysteme oder die Wirtschaftlichkeit beziehen. Die Organisation muss mögliche Maßnahmen zur Verbesserung festlegen und verwirklichen, um die beabsichtigten Ergebnisse des IMS zu erreichen. Dazu gehören auch das Korrigieren, Verhindern oder Verringern von unerwünschten Auswirkungen sowie die Erfüllung zukünftiger Erfordernisse und Erwartungen interessierter Parteien. Verbesserung kann in kleinen Schritten (stetig) oder in größeren Sprüngen erfolgen.
Voraussetzung für Best Practice
Wirksame Verbesserung erfordert einen strukturierten Ansatz unter Einschluss definierter Methoden. Verbesserung benötigt außerdem die Beteiligung von Personen aller Hierarchieebenen einer Organisation. Ohne stetige Verbesserung ist ein Erreichen des nachhaltigen Erfolgs mit Best Practice nicht möglich.
Wirksame Verbesserung erfordert einen strukturierten Ansatz unter Einschluss definierter Methoden. Verbesserung benötigt außerdem die Beteiligung von Personen aller Hierarchieebenen einer Organisation. Ohne stetige Verbesserung ist ein Erreichen des nachhaltigen Erfolgs mit Best Practice nicht möglich.
10.2 Nichtkonformität und Korrekturmaßnahmen
Bezug: 9001, 14001, 45001/10.2 und 50001/10.1
Tritt eine Nichtkonformität (z. B. Fehler) auf, muss die Organisation darauf reagieren, um Gegenmaßnahmen veranlassen zu können. Das können Maßnahmen sowohl der Überwachung als auch der Korrektur sein, ggf. auch beides. Um Maßnahmen einleiten zu können, sind das Ausmaß und die Ursache der Nichtkonformität zu ermitteln und ob weitere vergleichbare Nichtkonformitäten an anderer Stelle auftreten können. Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen der Nichtkonformität angemessen sein.
Tritt eine Nichtkonformität (z. B. Fehler) auf, muss die Organisation darauf reagieren, um Gegenmaßnahmen veranlassen zu können. Das können Maßnahmen sowohl der Überwachung als auch der Korrektur sein, ggf. auch beides. Um Maßnahmen einleiten zu können, sind das Ausmaß und die Ursache der Nichtkonformität zu ermitteln und ob weitere vergleichbare Nichtkonformitäten an anderer Stelle auftreten können. Korrekturmaßnahmen müssen den Auswirkungen der Nichtkonformität angemessen sein.
Die beschlossenen und umgesetzten Maßnahmen sind hinsichtlich ihrer Wirksamkeit zu überprüfen. Über den gesamten Vorgang müssen dokumentierte Informationen erstellt und aufbewahrt werden.
10.3 Verbesserung
Bezug: 9001, 14001, 45001/10.3 und 50001/10.2
Die Organisation muss die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des IMS fortlaufend verbessern, um den nachhaltigen Erfolg der Organisation zu steigern.
Die Organisation muss die Eignung, Angemessenheit und Wirksamkeit des IMS fortlaufend verbessern, um den nachhaltigen Erfolg der Organisation zu steigern.
Die Verbesserung des IMS soll die Organisation befähigen, die Erfordernisse und Erwartungen der interessierten Parteien frühzeitig zu erkennen und zu erfüllen. Die Organisation soll sicherstellen, dass Verbesserung ein fester Bestandteil der Kultur und Strategie ist. Dazu ist es notwendig, Personen zu befähigen, sich in Verbesserungsmaßnahmen konstruktiv einzubringen, und die notwendigen Ressourcen (z. B. Kompetenz, Zeit und weitere Mittel) dafür bereitzustellen. Ergebnisse des Verbesserungsprozesses sind als dokumentierte Information zu führen.
10.4 Lernen der Organisation
Bezug: 9004/11.3
Lernen ist ein wesentlicher Faktor, um Verbesserungen und Innovation zu generieren. Daher sollte die Organisation auf allen Ebenen lernen und die Steigerung der Fähigkeiten von Personen als strategischen Faktor ansehen. Wissen sollte als Vermögenswert der Organisation betrachtet werden, den es zu mehren gilt, um nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen. Erforderliches Wissen kann aus Quellen innerhalb oder außerhalb der Organisation kommen.
Lernen ist ein wesentlicher Faktor, um Verbesserungen und Innovation zu generieren. Daher sollte die Organisation auf allen Ebenen lernen und die Steigerung der Fähigkeiten von Personen als strategischen Faktor ansehen. Wissen sollte als Vermögenswert der Organisation betrachtet werden, den es zu mehren gilt, um nachhaltigen Erfolg zu ermöglichen. Erforderliches Wissen kann aus Quellen innerhalb oder außerhalb der Organisation kommen.
Steuerung des Wissens
Neben dem Wissenserwerb ist die Steuerung des Wissens ein bedeutender Faktor nachhaltigen Erfolgs. Zur Steuerung des Wissens gehört die gezielte Bereitstellung des Wissens, wie auch die Art der Bereitstellung. Schneller Zugang zu und effektive Nutzung von Wissen sowie der stetige Ausbau des Wissens im notwendigen Rahmen, sind für den Erfolg einer Organisation unverzichtbar.
Neben dem Wissenserwerb ist die Steuerung des Wissens ein bedeutender Faktor nachhaltigen Erfolgs. Zur Steuerung des Wissens gehört die gezielte Bereitstellung des Wissens, wie auch die Art der Bereitstellung. Schneller Zugang zu und effektive Nutzung von Wissen sowie der stetige Ausbau des Wissens im notwendigen Rahmen, sind für den Erfolg einer Organisation unverzichtbar.
10.5 Innovation
Bezug: 9004/11.4
Innovation ist ein Treiber, der zur Verbesserung der Leistung einer Organisation führt. Er bestimmt über die Marktposition einer Organisation sowie auch über andere Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Klimaschutz). Innovation kann sich auch aus den interessierten Parteien und ihren Anforderungen ergeben. Wichtig für die Organisation ist, dass sie spezifischen Innovationsbedarf erkennt und innovatives Denken in ihrem Umfeld zulässt.
Innovation ist ein Treiber, der zur Verbesserung der Leistung einer Organisation führt. Er bestimmt über die Marktposition einer Organisation sowie auch über andere Aspekte der Nachhaltigkeit (z. B. Klimaschutz). Innovation kann sich auch aus den interessierten Parteien und ihren Anforderungen ergeben. Wichtig für die Organisation ist, dass sie spezifischen Innovationsbedarf erkennt und innovatives Denken in ihrem Umfeld zulässt.
Innovationsprozess
Um Innovation zu fördern, sollte die Organisation Prozesse einführen und aufrechterhalten, die wirksame Innovation ermöglichen. Das schließt das Sammeln, Bearbeiten, Bewerten und Nutzbarmachen von Innovation ein. Dabei sollten Risiken und Chancen in Verbindung mit geplanten Innovationstätigkeiten bewertet werden, um mögliche negative wie positive Auswirkungen auf die Organisation zu berücksichtigen.
Um Innovation zu fördern, sollte die Organisation Prozesse einführen und aufrechterhalten, die wirksame Innovation ermöglichen. Das schließt das Sammeln, Bearbeiten, Bewerten und Nutzbarmachen von Innovation ein. Dabei sollten Risiken und Chancen in Verbindung mit geplanten Innovationstätigkeiten bewertet werden, um mögliche negative wie positive Auswirkungen auf die Organisation zu berücksichtigen.
Die Ergebnisse der Innovationsprozesse sollten regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft werden, um das Wissen der Organisation zu erweitern und mit der strategischen Ausrichtung der Organisation abzustimmen.
11.1 Allgemeines
Bezug: 9004/A.1
Die Methode der Selbstbewertung soll der Organisation den Status bezüglich des Reifegrads ihres (ihrer) Managementsystem(e) in einzelnen Feldern, aber auch im Ganzen aufzeigen. Daraus können Verbesserungsbereiche und Innovationschancen erkannt und priorisiert werden.
Die Methode der Selbstbewertung soll der Organisation den Status bezüglich des Reifegrads ihres (ihrer) Managementsystem(e) in einzelnen Feldern, aber auch im Ganzen aufzeigen. Daraus können Verbesserungsbereiche und Innovationschancen erkannt und priorisiert werden.
Ermittlung von Stärken und Schwächen
Die Selbstbewertung gemäß den Kriterien der ISO 9004 ist auch als Werkzeug zur Ermittlung von Stärken und Schwächen einer Organisation gedacht. Im Gegensatz zu normenbasierten Audits wird der Grad der Erfüllung von Auditkriterien nicht nur in erfüllt und nicht erfüllt unterschieden, sondern in skalierten Messgrößen angeben, die den Grad des Erreichens von nachhaltigem Erfolg (Best Practice) ausweisen. Das Ermitteln von Verbesserungspotenzial ist auch bei internen Audits ein Bestandteil der Auditdurchführung. Es gibt aber keine Aussage darüber, wie viel Verbesserungspotenzial in einem Prozess oder im gesamten IMS noch steckt. Mit der Selbstbewertung erhält man einen Status, wie groß der Abstand zum nachhaltigen Erfolg (Best Practice) für ein Auditkriterium wie z. B. Kompetenz oder Führung noch ist. Die Selbstbewertung prüft die Qualität der Auditkriterien hinsichtlich ihrer Güte und geht somit über die Ergebnisse von interner Audits hinaus. Den Zusammenhang zwischen internen Audits und der Selbstbewertung zeigt die Abbildung 11.
Abb. 11: Zusammenhang internes Audit – Selbstbewertung
Die Selbstbewertung gemäß den Kriterien der ISO 9004 ist auch als Werkzeug zur Ermittlung von Stärken und Schwächen einer Organisation gedacht. Im Gegensatz zu normenbasierten Audits wird der Grad der Erfüllung von Auditkriterien nicht nur in erfüllt und nicht erfüllt unterschieden, sondern in skalierten Messgrößen angeben, die den Grad des Erreichens von nachhaltigem Erfolg (Best Practice) ausweisen. Das Ermitteln von Verbesserungspotenzial ist auch bei internen Audits ein Bestandteil der Auditdurchführung. Es gibt aber keine Aussage darüber, wie viel Verbesserungspotenzial in einem Prozess oder im gesamten IMS noch steckt. Mit der Selbstbewertung erhält man einen Status, wie groß der Abstand zum nachhaltigen Erfolg (Best Practice) für ein Auditkriterium wie z. B. Kompetenz oder Führung noch ist. Die Selbstbewertung prüft die Qualität der Auditkriterien hinsichtlich ihrer Güte und geht somit über die Ergebnisse von interner Audits hinaus. Den Zusammenhang zwischen internen Audits und der Selbstbewertung zeigt die Abbildung 11.
Unterschied
Das zentrale Ergebnis eines Audits ist die Aussage, ob das oder die Managementsystem(e) die Konformität von normativen Regelwerken erfüllt/-en. Die Selbstbewertung sagt aus, wie weit das System noch von nachhaltiger Bestleistung entfernt ist. Die Selbstbewertung der ISO 9004 ist somit ein Instrument des stetigen Verbesserungsprozesses.
Das zentrale Ergebnis eines Audits ist die Aussage, ob das oder die Managementsystem(e) die Konformität von normativen Regelwerken erfüllt/-en. Die Selbstbewertung sagt aus, wie weit das System noch von nachhaltiger Bestleistung entfernt ist. Die Selbstbewertung der ISO 9004 ist somit ein Instrument des stetigen Verbesserungsprozesses.
Chance
Um den Aufwand der Überprüfung des IMS hinsichtlich der geforderten Ermittlung der Normenkonformität und Ermittlung von strukturiertem Verbesserungspotenzial zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, beide Ansätze miteinander zu verbinden.
Um den Aufwand der Überprüfung des IMS hinsichtlich der geforderten Ermittlung der Normenkonformität und Ermittlung von strukturiertem Verbesserungspotenzial zu begrenzen, besteht die Möglichkeit, beide Ansätze miteinander zu verbinden.
11.2 Reifegradmodell und internes Audit
Bezug: IMS/9.2 und 9004/A.2
Um das Reifegradmodell und interne Audits miteinander zu kombinieren, muss die von der HLS abweichende Struktur der ISO 9004 an die HLS angepasst werden, von Normkapitel 4 „Kontext der Organisation” bis Normkapitel 10 „Verbesserung”. Für die Themen der ISO 9004, die keine direkten Anknüpfungspunkte an die HLS haben, musste ein zusätzliches Kapitel dem Normkapitel 4 vorangestellt werden. Darin sind Themen wie „Qualität einer Organisation und nachhaltiger Erfolg” und „Identität einer Organisation” gebündelt. Das damit entstandene Normkapitel 3 „Wesen der Organisation” bildet den Rahmen für das Selbstverständnis der Organisation und gibt eine Richtschnur, was unter „nachhaltigem Erfolg” zu verstehen ist.
Um das Reifegradmodell und interne Audits miteinander zu kombinieren, muss die von der HLS abweichende Struktur der ISO 9004 an die HLS angepasst werden, von Normkapitel 4 „Kontext der Organisation” bis Normkapitel 10 „Verbesserung”. Für die Themen der ISO 9004, die keine direkten Anknüpfungspunkte an die HLS haben, musste ein zusätzliches Kapitel dem Normkapitel 4 vorangestellt werden. Darin sind Themen wie „Qualität einer Organisation und nachhaltiger Erfolg” und „Identität einer Organisation” gebündelt. Das damit entstandene Normkapitel 3 „Wesen der Organisation” bildet den Rahmen für das Selbstverständnis der Organisation und gibt eine Richtschnur, was unter „nachhaltigem Erfolg” zu verstehen ist.
Reifegradlevel
Das Selbstbewertungsinstrument der ISO 9004 nutzt fünf Reifegradlevel (Level 1 bis 5) zur Einstufung des noch bestehenden Verbesserungspotenzials. Für die Prüfung auf Normenkonformität der Systeme im IMS muss noch eine weitere Stufe hinzugefügt werden. Das Einfügen weitere Reifegradstufen durch den Nutzer ist in der ISO 9004 explizit vorgesehen. Die Stufe 0 ist die Bewertung, wenn zu einem Unterelement (Prozess) eine Nichtkonformität vorliegt. Die Einstufung 1 ist die Basisbewertung für ein konformes Auditergebnis. In der Praxis wäre das ein frisch eingeführtes Managementsystem bei der Erstzertifizierung (ohne Abweichung), bei dem erfahrungsgemäß noch sehr viel Verbesserungspotenzial vorhanden ist.
Das Selbstbewertungsinstrument der ISO 9004 nutzt fünf Reifegradlevel (Level 1 bis 5) zur Einstufung des noch bestehenden Verbesserungspotenzials. Für die Prüfung auf Normenkonformität der Systeme im IMS muss noch eine weitere Stufe hinzugefügt werden. Das Einfügen weitere Reifegradstufen durch den Nutzer ist in der ISO 9004 explizit vorgesehen. Die Stufe 0 ist die Bewertung, wenn zu einem Unterelement (Prozess) eine Nichtkonformität vorliegt. Die Einstufung 1 ist die Basisbewertung für ein konformes Auditergebnis. In der Praxis wäre das ein frisch eingeführtes Managementsystem bei der Erstzertifizierung (ohne Abweichung), bei dem erfahrungsgemäß noch sehr viel Verbesserungspotenzial vorhanden ist.
Einstufung
Gemäß dieser Systematik wären viele Systeme, die schon mehr als einen Zertifizierungszyklus (drei Jahre) Praxiserfahrung durchlaufen haben, im Mittel über alle Prozesse in Stufe 2 oder teilweise auch in 3 einzustufen. Die Stufe 5 wäre zu vergeben, wenn die Vorgehensweise in den Prozessen hinsichtlich der Normenanforderungen, im Vergleich mit anderen Organisationen bester Praxis entspricht. Darüber hinaus gilt das auch für Themen, die nicht von Normen des IMS gefordert werden, aber bezüglich der ISO 9004 für die Nachhaltigkeit bedeutsam sind und Bestkriterien erfüllen sollten.
Gemäß dieser Systematik wären viele Systeme, die schon mehr als einen Zertifizierungszyklus (drei Jahre) Praxiserfahrung durchlaufen haben, im Mittel über alle Prozesse in Stufe 2 oder teilweise auch in 3 einzustufen. Die Stufe 5 wäre zu vergeben, wenn die Vorgehensweise in den Prozessen hinsichtlich der Normenanforderungen, im Vergleich mit anderen Organisationen bester Praxis entspricht. Darüber hinaus gilt das auch für Themen, die nicht von Normen des IMS gefordert werden, aber bezüglich der ISO 9004 für die Nachhaltigkeit bedeutsam sind und Bestkriterien erfüllen sollten.
Tabelle 2: Systematik für Selbstbewertungstabelle
Reifegrad in Bezug auf den nachhaltigen Erfolg | ||||||
Reifegrad | Grad 0 | Grad 1 | Grad 2 | Grad 3 | Grad 4 | Grad 5 |
Abweichung | Basisreifegrad | Entwicklungsreifegrad | Fortschrittsreifegrad | Qualitätsreifegrad | Nachhaltiger Erfolg | |
Einstufungsaspekte | Nichterfüllung einer Normenforderung | Erstzertifizierung ohne Abweichung | Gelebtes System mit großem Verbesserungspotenzial | Gelebtes System mit mittlerem Verbesserungspotenzial | Gelebtes System mit geringem Verbesserungspotenzial | Bestmögliche Praktiken |
Dem Beitrag ist eine sechzigseitige Arbeitshilfe beigefügt mit einer tabellarischen Audit- und Selbstbewertungsliste für ein Integriertes Managementsystem (IMS). Methodisch sind die Tabellen der ISO 9004 entnommen. Wo notwendig oder nützlich, wurden sie verändert oder ergänzt, um den Anforderungen der Managementsysteme des IMS zu entsprechen. In anderen Fällen mussten auch zusätzliche Selbstbewertungstabellen erstellt und in die Struktur der Hauptelemente der Selbstbewertung integriert werden. Die Tabellen der Hauptelemente Nr. 3 bis 10 bieten damit einen Katalog von Leistungskriterien, um zu einer nachvollziehbaren Einstufung in die fünf Reifegrade zu kommen. Der Katalog bildet dabei sowohl die Anforderungen der ausgewählten IMS ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 und ISO 50001 ab als auch die der ISO 9004.[ 06304_01.docx]
06304_01.docx]
 06304_01.docx]
06304_01.docx]Acht Hauptelemente
Unter Berücksichtigung der HLS gegliedert der Katalog sich in acht Hauptelemente:
Unter Berücksichtigung der HLS gegliedert der Katalog sich in acht Hauptelemente:
| 3. | Wesen der Organisation |
| 4. | Kontext der Organisation |
| 5. | Führung |
| 6. | Planung |
| 7. | Unterstützung |
| 8. | Betrieb |
| 9. | Bewertung der Leistung |
| 10. | Verbesserung |
Jedes Hauptelement enthält weitere Unterelemente, in denen sich die Anforderungen von Prozessen befinden. Es sind lediglich die wesentlichen Kernanforderungen der betrachteten Normen wiedergegeben. Zur Audit- und Selbstbewertungsdurchführung sind die detaillierten Anforderungsbeschreibungen der spezifischen Normentexte zu verwenden.
11.3 Selbstbewertung einzelner Elemente
Bezug: 9004/A.3
Wie für die internen Audits, muss festgelegt werden, wer für die Planung und Durchführung der Selbstbewertung verantwortlich sein soll. Auch die dafür benötigte Kompetenz ist festzulegen. Da über den Auditprozess in einem IMS bereits entsprechende Regelungen für die Planung und Umsetzung interner Audits vorhanden sind, kann man sich ihrer bedienen. In die Auditprogrammplanung des IMS kann die Planung der Selbstbewertung integriert werden. Gleiches gilt für die Auditdurchführung. Hinsichtlich der Kompetenz sollten interne Auditoren, die den Anforderungen der ISO 19011 genügen, auch in der Lage sein, eine Selbstbewertung durchzuführen, wenn sie in die Methodik der Selbstbewertung eingewiesen sind. Unter diesen Voraussetzungen sollte eine integrative Durchführung von internem Audit und Selbstbewertung jederzeit möglich sein.
Wie für die internen Audits, muss festgelegt werden, wer für die Planung und Durchführung der Selbstbewertung verantwortlich sein soll. Auch die dafür benötigte Kompetenz ist festzulegen. Da über den Auditprozess in einem IMS bereits entsprechende Regelungen für die Planung und Umsetzung interner Audits vorhanden sind, kann man sich ihrer bedienen. In die Auditprogrammplanung des IMS kann die Planung der Selbstbewertung integriert werden. Gleiches gilt für die Auditdurchführung. Hinsichtlich der Kompetenz sollten interne Auditoren, die den Anforderungen der ISO 19011 genügen, auch in der Lage sein, eine Selbstbewertung durchzuführen, wenn sie in die Methodik der Selbstbewertung eingewiesen sind. Unter diesen Voraussetzungen sollte eine integrative Durchführung von internem Audit und Selbstbewertung jederzeit möglich sein.
Auswertung
Die Auswertung von internem Audit und Selbstbewertung kann klar voneinander abgegrenzt werden. Das Auditergebnis liefert die Aussage, ob Nichtkonformitäten im Managementsystem festgestellt worden sind und an welcher Stelle. Der weitere Ablauf entspricht den Festlegungen des Managementsystems nach den Normkapiteln 9.2 (Interne Audits) und 10.2 (Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen).
Die Auswertung von internem Audit und Selbstbewertung kann klar voneinander abgegrenzt werden. Das Auditergebnis liefert die Aussage, ob Nichtkonformitäten im Managementsystem festgestellt worden sind und an welcher Stelle. Der weitere Ablauf entspricht den Festlegungen des Managementsystems nach den Normkapiteln 9.2 (Interne Audits) und 10.2 (Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen).
Selbstbewertung deckt Verbesserungspotenzial auf
Die Selbstbewertung setzt beim Thema der Verbesserung ein. Im Gegensatz zur bestehenden Praxis, in der isolierte Verbesserungsvorschläge aus dem internen Audit nur zu punktuellen Verbesserungen im System führen, wird in der Selbstbewertung zuerst der Reifegrad des IMS ermittelt. Der zeigt an, wieviel Verbesserungspotenzial an welcher Stelle noch im IMS steckt. Je mehr Potenzial, desto mehr Verbesserungsvorschläge sind möglich. Damit können verschiedene Strategien der Verbesserung durch die Organisation verfolgt werden, z. B. das gesamte System in allen Segmenten auf ein definiertes Level zu heben oder Schwerpunkte in den einzelnen Hauptelementen zu setzen, um dort beste Praktiken (Level 5) zu erreichen.
Die Selbstbewertung setzt beim Thema der Verbesserung ein. Im Gegensatz zur bestehenden Praxis, in der isolierte Verbesserungsvorschläge aus dem internen Audit nur zu punktuellen Verbesserungen im System führen, wird in der Selbstbewertung zuerst der Reifegrad des IMS ermittelt. Der zeigt an, wieviel Verbesserungspotenzial an welcher Stelle noch im IMS steckt. Je mehr Potenzial, desto mehr Verbesserungsvorschläge sind möglich. Damit können verschiedene Strategien der Verbesserung durch die Organisation verfolgt werden, z. B. das gesamte System in allen Segmenten auf ein definiertes Level zu heben oder Schwerpunkte in den einzelnen Hauptelementen zu setzen, um dort beste Praktiken (Level 5) zu erreichen.
Die dem Beitrag beigefügte Arbeitshilfe zur Bewertungseinstufung enthalten die Tabellen zur ISO 9004 sowie ergänzende Tabellen zu IMS-Themen, die eine größere Bedeutung für die Nachhaltigkeit haben. Normative Forderungen ohne wesentlichen Bezug zur Nachhaltigkeit werden nur durch das interne Audit im Rahmen der Systemprüfung hinsichtlich Konformität und Verbesserungspotenzial erfasst.[ 06304_01.docx]
06304_01.docx]
 06304_01.docx]
06304_01.docx]Am Anfang der Arbeitshilfe finden Sie eine Zuordnungsmatrix zwischen den Normenforderungen des IMS – NF und den Bewertungstabellen der Selbstbewertung (Nachhaltigkeitselemente – NE). Die Normenpunkte ohne Nachhaltigkeitselemente sind darüber identifizierbar.
11.4 Anwendung der Selbstbewertungsinstrumente
Bezug: 9004/A.4
Die Selbstbewertung kann für einzelne Hauptelemente (z. B. Führung oder Verbesserung) wie auch für das gesamte IMS, einschließlich der Themen, die aus der ISO 9004 ergänzend hinzugekommen sind, angewendet werden. Darüber hinaus können, wenn die Organisation es für wichtig hält, auch weitere Themen der Nachhaltigkeit in die Selbstbewertung aufgenommen werden (z. B. ISO 37001, Antikorruptionsmanagement).
Die Selbstbewertung kann für einzelne Hauptelemente (z. B. Führung oder Verbesserung) wie auch für das gesamte IMS, einschließlich der Themen, die aus der ISO 9004 ergänzend hinzugekommen sind, angewendet werden. Darüber hinaus können, wenn die Organisation es für wichtig hält, auch weitere Themen der Nachhaltigkeit in die Selbstbewertung aufgenommen werden (z. B. ISO 37001, Antikorruptionsmanagement).
Anhand der vorgegebenen Kriterien in den Tabellen der Unterelemente wird zuerst der Reifegrad dieses Unterelements bestimmt. Sind mehrere Einzelkriterien in einem Unterelement mit „ja” zu bewerten, um es zu erfüllen, müssen auch alle Einzelkriterien erfüllt sein. Ansonsten ist das darunterliegende Level das Ergebnis.
Anhand der Einstufung sind systematisch Verbesserungsvorschläge zur Erreichung des nächsthöheren Levels durch die Auditoren/Selbstbewerter zu machen. Im Rahmen der Einstufung eines Unterelements ist parallel zu überprüfen, ob die Normenkonformität zu den Anforderungen des IMS für dieses Unterelement gegeben ist.
Beispiel Abweichung
Bei einer Abweichung ist dieses Unterelement mit 0 in der Reifegradbewertung zu belegen (Einstufung 1 sieht „abweichungsfrei” vor). Die Abweichung ist mit Angabe der spezifischen Norm (z. B. ISO 9001) und dem Normenkapitel (z. B. 9.1.2) sowie der Abweichungsfeststellung „Keine durchgängige Lieferantenbewertung” in der Kriterienliste für das zutreffende Unterelement zu dokumentieren. Wenn mehrere Normen des IMS davon betroffen sind, sind diese ebenfalls zu dokumentieren (z. B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) unter Angabe des Normenkapitels (z. B. 9.3) und der Auditabweichungsfeststellung „Managementreview nicht durchgeführt”.
Bei einer Abweichung ist dieses Unterelement mit 0 in der Reifegradbewertung zu belegen (Einstufung 1 sieht „abweichungsfrei” vor). Die Abweichung ist mit Angabe der spezifischen Norm (z. B. ISO 9001) und dem Normenkapitel (z. B. 9.1.2) sowie der Abweichungsfeststellung „Keine durchgängige Lieferantenbewertung” in der Kriterienliste für das zutreffende Unterelement zu dokumentieren. Wenn mehrere Normen des IMS davon betroffen sind, sind diese ebenfalls zu dokumentieren (z. B. ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001) unter Angabe des Normenkapitels (z. B. 9.3) und der Auditabweichungsfeststellung „Managementreview nicht durchgeführt”.
Einzelmeinung vermeiden
In der Praxis werden interne Audits häufig nur von einem Auditor durchgeführt, was die Qualität des Auditergebnisses nicht immer fördert. Bei der Kombination internes Audit plus Selbstbewertung sollte auf das Vier-Augen-Prinzip zurückgegriffen werden. Gerade bei der Bewertung zur Einstufung des Reifegrads sollte eine Einzelmeinung vermieden werden. Die letztliche Einstufungsbewertung des Reifegrads sollte einstimmig beschlossen sein.
In der Praxis werden interne Audits häufig nur von einem Auditor durchgeführt, was die Qualität des Auditergebnisses nicht immer fördert. Bei der Kombination internes Audit plus Selbstbewertung sollte auf das Vier-Augen-Prinzip zurückgegriffen werden. Gerade bei der Bewertung zur Einstufung des Reifegrads sollte eine Einzelmeinung vermieden werden. Die letztliche Einstufungsbewertung des Reifegrads sollte einstimmig beschlossen sein.
Verbesserungsvorschläge
Auch wenn es um das Formulieren von Verbesserungsvorschlägen (quantitativ sowie qualitativ) geht, sind zwei Köpfe besser als ein Kopf. Verbesserungsvorschläge sind als Merkpunkte in dem Kriterienkatalog des Unterelements zu vermerken (Ergebnisse/Kommentare: Vorschlag 1, 2 usw.). Der genaue Vorschlag, in Form einer kurzen Beschreibung, ist in einer Vorschlagsliste zu dokumentieren.
Auch wenn es um das Formulieren von Verbesserungsvorschlägen (quantitativ sowie qualitativ) geht, sind zwei Köpfe besser als ein Kopf. Verbesserungsvorschläge sind als Merkpunkte in dem Kriterienkatalog des Unterelements zu vermerken (Ergebnisse/Kommentare: Vorschlag 1, 2 usw.). Der genaue Vorschlag, in Form einer kurzen Beschreibung, ist in einer Vorschlagsliste zu dokumentieren.
Ergebnisverdichtung
Im Rahmen der Ergebniszusammenfassung der Auditoren/Selbstbewerter sind die Einzelbewertungen der Unterelemente auf das darüberliegende Hauptelement (z. B. Leitung) durch Mittelwertbildung zu verdichten. Da bei dieser Verdichtung ggf. aber Abweichungen in einem Unterelement nicht mehr transparent wären, sollte man das gesamte Hauptelement per Definition mit 0 bewerten (K.o.-Kriterium), da das Nichterfüllen von Basisanforderungen (Abweichung) das genaue Gegenteil von nachhaltigem Erfolg darstellt.
Im Rahmen der Ergebniszusammenfassung der Auditoren/Selbstbewerter sind die Einzelbewertungen der Unterelemente auf das darüberliegende Hauptelement (z. B. Leitung) durch Mittelwertbildung zu verdichten. Da bei dieser Verdichtung ggf. aber Abweichungen in einem Unterelement nicht mehr transparent wären, sollte man das gesamte Hauptelement per Definition mit 0 bewerten (K.o.-Kriterium), da das Nichterfüllen von Basisanforderungen (Abweichung) das genaue Gegenteil von nachhaltigem Erfolg darstellt.
Eine weitere Verdichtung der Hauptelemente (Mittelwertbildung) zu einer Reifgradzahl für die gesamte Organisation ist theoretisch möglich, bringt in der Praxis aber nicht viel, da Maßnahmen zur Verbesserung kein strategisches Thema sind, sondern operativ behandelt werden müssen.
Abschlussbesprechung
Der Abschluss des internen Audits/der Selbstbewertung folgt der Vorgehensweise, wie sie beim internen Audit gängige Praxis ist. Die Auditoren/Selbstbewerter werten das Audit-/Selbstbewertungsergebnis aus und präsentieren es in einer Abschlussbesprechung. Der Umgang mit Abweichungen im Auditergebnis folgt bekannten normativen Regeln (IMS, 9.2).
Der Abschluss des internen Audits/der Selbstbewertung folgt der Vorgehensweise, wie sie beim internen Audit gängige Praxis ist. Die Auditoren/Selbstbewerter werten das Audit-/Selbstbewertungsergebnis aus und präsentieren es in einer Abschlussbesprechung. Der Umgang mit Abweichungen im Auditergebnis folgt bekannten normativen Regeln (IMS, 9.2).
Umgang mit Verbesserungsvorschlägen
Der Umgang mit Vorschlägen zur Verbesserung sollte strukturierter und effizienter ablaufen als es zurzeit häufig in der Praxis üblich ist. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:
Der Umgang mit Vorschlägen zur Verbesserung sollte strukturierter und effizienter ablaufen als es zurzeit häufig in der Praxis üblich ist. Zwei Möglichkeiten bieten sich an:
| 1. | Im Abschlussgespräch werden die einzelnen Verbesserungsvorschläge im Hinblick auf ihre Umsetzung mittels einer Risiko-Chancen-Bewertung mit den beteiligten Bereichen abgestimmt. Die genaue Formulierung der Verbesserungsmaßnahme wird dem betroffenen Bereich unter Fristsetzung zur Erledigung überlassen. Der Bereich hat für die Vorschläge eine Priorisierung vorzunehmen. Entsprechend der Priorität hat der Bereich für jede Maßnahme einen detaillierten Maßnahmenplan aufzustellen. Die Maßnahmenpläne sind den Auditoren zur Kenntnis zu geben. Die Umsetzung der Maßnahmenpläne wird durch Regelungen des IMS (9.2, Nichtkonformitäten und Korrekturmaßnahmen) überwacht. |
| 2. | Im Abschlussgespräch werden die Verbesserungsmaßnahmen ähnlich behandelt wie Abweichungen; sie werden durch die Auditoren nur kurz erläutert. Die weitere Behandlung findet zeitnah in Arbeitsgruppen mit den beteiligten Bereichen statt. Unter Beteiligung der Auditoren werden die Maßnahmen in den Arbeitsgruppen geprüft und die Umsetzung wird im Detail besprochen. Die Maßnahmenpläne mit Regelung der Verantwortlichkeiten und der Ressourcen werden im Nachgang durch die beteiligten Bereiche erstellt und den Auditoren zur Kenntnis gegeben. Die Umsetzung der Maßnahmen erfolgt wie in Möglichkeit 1. |
Wenn nicht anders vereinbart, wird im/in der nächsten internen Audit/Selbstbewertung die Umsetzung der Verbesserungsmaßnahmen im Hinblick auf eine veränderte Einstufung des Reifgrads überprüft.
Auditbericht
Der bisherige klassische Auditbericht wird strukturell an die Bedürfnisse der Selbstbewertung angepasst. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in zwei Abschnitten: dem Teil des Audits mit der Konformität oder Nichtkonformität (normativ) und dem Teil der Selbstbewertung (nachhaltiger Erfolg) mit der aktuellen Einstufung sowie den ermittelten Verbesserungspotenzialen.
Der bisherige klassische Auditbericht wird strukturell an die Bedürfnisse der Selbstbewertung angepasst. Die Ergebnisdarstellung erfolgt in zwei Abschnitten: dem Teil des Audits mit der Konformität oder Nichtkonformität (normativ) und dem Teil der Selbstbewertung (nachhaltiger Erfolg) mit der aktuellen Einstufung sowie den ermittelten Verbesserungspotenzialen.
Der Umgang und die konkrete Arbeit mit den Fragelisten der Selbstbewertung, ist detailliert im Leitfaden zur Durchführung des internen Audits/der Selbstbewertung beschrieben. Der Leitfaden ist als Arbeitshilfe beigefügt.[ 06304_d.docx]
06304_d.docx]
 06304_d.docx]
06304_d.docx]Visualisierung
Der Verbesserungsteil mit der Einstufungsbewertung würde eine teilweise grafische Auswertung (Diagramm) ermöglichen, wie man sie aus dem EFQM-Modell kennt. Zwei Darstellungsformen wären praktikabel: die Radardarstellung (wie im EFQM üblich) oder das Balkendiagramm (vgl. Abbildung 12).
Abb. 12: Grafische Darstellungsformen – Selbstbewertung
Der Verbesserungsteil mit der Einstufungsbewertung würde eine teilweise grafische Auswertung (Diagramm) ermöglichen, wie man sie aus dem EFQM-Modell kennt. Zwei Darstellungsformen wären praktikabel: die Radardarstellung (wie im EFQM üblich) oder das Balkendiagramm (vgl. Abbildung 12).
Bewertungspunkte wären die Hauptelemente der Selbstbewertung mit ihrer Einstufung (im vorliegenden Fall acht Hauptelemente). Das Balkendiagramm bietet den Vorteil, dass Ergebnisse vergangener Jahre (Trenddarstellung) mit in die Darstellung einbezogen werden können. Auf gleichem Wege könnte mit der Auswertung der Unterelemente in jedem der acht Hauptelemente verfahren werden.
Als weiteres Hilfsmittel dient die Excel-Tabelle zur Auswertung und Visualisierung des Gesamtergebnisses des internen Audits und der Selbstbewertung.[ 06304_e.xlsx]
06304_e.xlsx]
 06304_e.xlsx]
06304_e.xlsx]Der Excel-Tabelle beigestellt sind noch drei mitgeltende Dokumente, die Sie zu Protokollierungszwecken und als Abschlussdokument nutzen können:
Protokoll NichtkonformitätenDas ergänzende Dokument können Sie zum Protokollieren von Nichtkonformitäten nutzen.[ 06304_f.docx]
06304_f.docx]
 06304_f.docx]
06304_f.docx]Protokoll VerbesserungsvorschlägeDas ergänzende Dokumente können Sie zum Protokollieren von Verbesserungsvorschläge nutzen.[ 06304_g.docx]
06304_g.docx]
 06304_g.docx]
06304_g.docx]Zusammenfassung der SelbstbewertungDas ergänzende Dokument können Sie zum Zusammenfassen der Selbstbewertung nutzen.[ 06304_h.docx]
06304_h.docx]
 06304_h.docx]
06304_h.docx]Quellen
1
DIN EN ISO 9001:2015 – Qualitätsmanagementsysteme – Anforderungen (ISO 9001:2015); Deutsche Fassung
2
DIN EN ISO 14001:2015 – Umweltmanagementsysteme –Anforderungen mit Anleitungen zur Anwendung (ISO 14001:2015); Deutsche Fassung
3
DIN EN ISO 45001:2018 – Managementsysteme für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit – Anforderungen mit Anleitungen zur Anwendung (ISO 45001:2018); Deutsche Fassung
4
DIN EN ISO 50001:2018 – Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung (ISO 50001:2018); Deutsche Fassung
5
DIN EN ISO 9004:2018 – Qualitätsmanagement – Qualität einer Organisation – Anleitung zum Erreichen nachhaltigen Erfolgs (ISO 9004:2018); Deutsche Fassung
6
DIN EN ISO 19011:2018 – Leitfaden zur Auditierung von Managementsystemen (ISO 19011:2018); Deutsche Fassung
11
IHK Düsseldorf: European Sustainability Reporting Standards (ESRS)
12
Rat für Nachhaltige Entwicklung: Leitfaden, Checkliste & Co. zum Deutschen Nachhaltigkeitskodex (2022)
13
European Foundation for Quality Management: EFQM Modell 2020